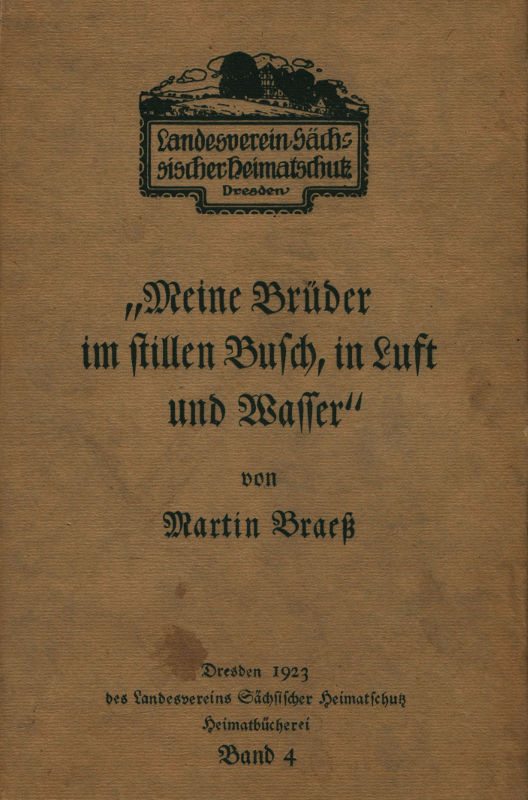
The Project Gutenberg EBook of »Meine Brüder im stillen Busch, in Luft und Wasser«, by Martin Braeß This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: »Meine Brüder im stillen Busch, in Luft und Wasser« Author: Martin Braeß Release Date: June 2, 2020 [EBook #62311] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK »MEINE BRÜDER IM STILLEN *** Produced by the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.
Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.
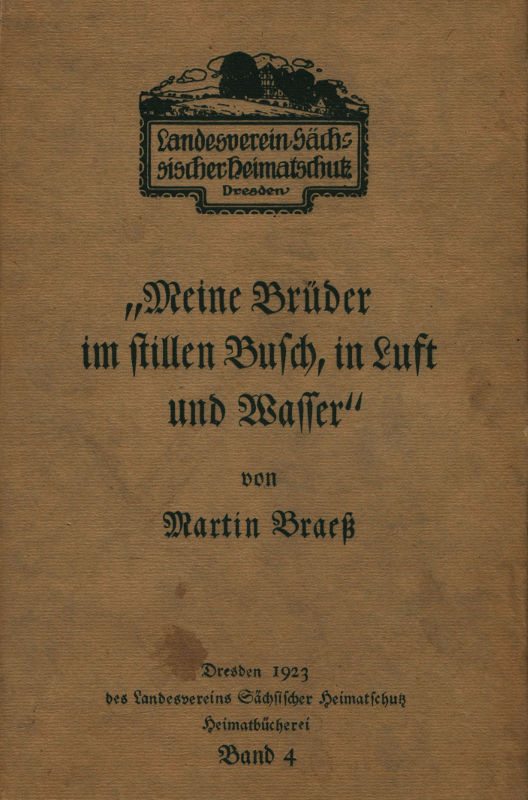
von
Martin Braeß
4. Band der Heimatbücherei
des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz
Dresden 1923
Otto Wigand'sche
Buchdruckei in
Leipzig
Den Deutschen in Nordböhmen
als Dank für ihre
dem Landesverein »Sächsischer Heimatschutz«
in schwerer Zeit geleistete Hilfe
| Das Tier im Landschaftsbild unserer Heimat | 5 |
| Die volkstümlichsten Tiere der deutschen Märchen und Fabeln | 41 |
| Allerlei Fischräuber, bepelzt und befiedert | 75 |
| Malepartus, die Raubburg und Kinderstube von »Reinke de Vos« | 109 |
| Swinegel un sine Sippschaft | 120 |
| Vogelnester | 148 |
| Im Teichgebiet der sächsischen Lausitz | 161 |
| Die heimatliche Vogelwelt im deutschen Volksglauben | 179 |
| Schutz den schutzlosen Kriechtieren und Lurchen! | 201 |
| Sechsbeinig, achtbeinig und ohne Beine | 230 |
Das Leben auf unserer Erde kennt keine Schranke, kein Grenzstein ist ihm gesetzt. Und es sind nicht nur die niedrigsten Lebewesen, einzellige Algen, Pilze, Infusorien, die sich sozusagen überall einstellen, nein, wenigstens von der Tierwelt gilt es, daß sich gerade ihre höchsten Vertreter, die Wirbeltiere, die ganze Welt erobert haben.
Aus den größten Tiefen der Ozeane, wo längst keine Pflanze mehr gedeiht, wo ewige Finsternis herrscht, bis auf die Flammen, die sich die Tiere selbst anzünden, hat man eine erstaunliche Artenzahl wohlorganisierter Fische ans Licht befördert, und hoch über der Waldgrenze der Gebirge, wo nur noch kurzrasiges Gras an dem Steilhang emporklettert und niedrige Alpenblumen ihre farbensatten Sterne dem Sonnenstrahl öffnen, ja noch höher droben, wohin keine blühende Pflanze mehr folgt, wo der zackige Felsengrat nackt und tot aus dem Firnschnee zum Himmel emporstarrt, da haftet der Fuß der flüchtigen Gemse, des Steinbocks, da pfeift im Steintrümmermeer das Murmeltier vor seiner Höhle. Über allem Irdischen aber, an der blauen Glocke des Himmels, schwebt in erhabener Ruhe der Adler, der König der Lüfte.
In solcher Einsamkeit herrscht dann das Tier als einzige Staffage der Landschaft: der nackten Felsenzinnen oder des einförmigen Wüstensandes, der weiten Meeresfläche oder des unermeßlichen Luftozeans, und nirgends sonst erreicht der Eindruck des Lebendigen solche Stärke.
Im übrigen aber vermag die Tierwelt nur in besonderen Ausnahmefällen der Landschaft einen bestimmten Wesenszug aufzuprägen; sie tritt in dieser Beziehung hinter der Pflanzenwelt weit zurück. Diese ist es, die das Bild beherrscht; an ihr haftet das Auge.
Düster, in blauschwärzlicher Färbung schaut der Nadelwald von den Höhen herab auf die Ebene, wo unter der weißen Decke das Samenkorn schlummert. Halbverschneite Hecken am Wege, ein einzelner Baum am Rain, ein kleines Feldgehölz, das seine kahlen Äste und Zweiglein zum bleigrauen Himmel erhebt, abgestorbene Stauden, deren Samenrispen zwischen den Schneewehen emporragen, erhöhen den Eindruck der Einsamkeit. Totenstille in der Natur.
Die freundliche Au, vom gewundenen Bächlein durchfeuchtet, hat der Frühling mit tausend Blüten geschmückt; lebensfroh schauen sie zum Lichte empor. Vergißmeinnicht: ihr Blau ein Abbild des Himmels; Löwenzahn, Ranunkulus, Dotterblume: goldenen Sonnen vergleichbar. Aus den alten Weidenstümpfen streben rötliche Triebe empor mit gelbgrünen Schmalblättern, während das Erlengestrüpp sein junges, glänzendes Laub über das plätschernde Wasser ausbreitet, in dem sein Spiegelbild zittert wie vor Erwartung seligster Lust.
Vom stahlblauen Himmelsgewölbe strahlt die Julisonne herab auf die Fruchtebene. Ein einziges Getreidefeld, wohin man nur schaut. Die braungoldenen Weizenähren[7] wogen wellenförmig im heißen Lufthauch, der tosend über sie hinstreicht. Ein Bild der einförmigen Steppe; kein Baum, kein Strauch. Hier herrschen die Fruchtgräser, von der Hand des Landmanns angebaut. Nur am Rain glüht es rot, großblütiger Mohn, und tiefblau schaut die Zyane aus dem lichtgelben Halmenmeer hervor.
Der herbstliche Laubwald: in allen Farben und Tönen glänzt es und gleißt es, vom zartesten Rosa bis zum sattesten Rot, vom lichtesten Gelb bis zum tiefsten Bronzeton. Und wenn die goldne Oktobersonne vom wolkenfreien Himmel herab all die Farbenflecke mit einer Fülle von Licht, von brennender Glut überschüttet, wenn sie lange Schlaglichter tief in den Wald wirft und helle Zitterkringel auf den Boden malt, daß auch das abgestorbene Laub noch einmal aufleuchtet: ein Farbenbild von wunderbarem Reiz, ein Farbeneinklang, der nicht seinesgleichen hat.
Im Kreislauf des Jahres die Pflanzenwelt ist's, die unsern heimatlichen Landschaftsbildern ein ganz bestimmtes Gepräge verleiht. Ihr ordnet sich alles unter, selbst der geologische Aufbau des Bodens, der doch gleichfalls von allergrößter Bedeutung ist. Das Tier aber erscheint dem gegenüber als eine viel weniger wichtige Zugabe zum Landschaftsbild, mehr zufällig bloß; man achtet seiner, nur weil man's gerade bemerkt. Fehlte es, der Anblick, der ganze äußere Eindruck wäre dennoch der gleiche; nur in besonderen Fällen wird man sich der fehlenden Tierwelt als eines wirklichen Mangels der Landschaft bewußt.
Und doch, wo immer es sei: ob sich die Pflanzenwelt in Macht und Fülle aufbaut, daß die Baumriesen ihre[8] Äste und Zweige zu gotischem Dach über dem Wanderer wölben, oder ob nur spärliche Gräser die weite Fläche dürftig bedecken; zu welcher Jahreszeit immer: ob der Winter seine Herrschaft führt, daß der Waldbach, in eisige Fesseln gebannt, nur leise plätschernd unter dem starren Panzer dahinmurmelt und der Stamm des Hochwaldes vor Frost tiefächzend zersplittert; zu welcher Stunde des Tages auch: ob die Mittagsglut auf der Flur liegt, drückend schwül, kein atmendes Lüftchen, ob der Mond sein silbernes Licht über den schlafenden Waldsee ergießt oder ob Morgennebel das Tal in dichte Schleier hüllen – nur ein einziges Tier in solchem Bild, ein einziger Schrei oder Ruf, die Strophe nur eines Vögleins, und sofort wird der Reiz der Landschaft erhöht, der ganze Eindruck in einer Weise gesteigert, daß wir das Bild vor uns wie mit einem Schlage in ganz anderem Lichte sehen.
Woher dieser Zauber? Wir sind nicht mehr allein, nicht mehr die einzig fühlende Brust; ein anderes Wesen nimmt teil an dem, was unsre Sinne schauen, unser Herz bewegt. Das Tier ist's, durch das Mutter Natur zu uns redet, das beseelte Geschöpf. Seine Erscheinung, sein Leben und Treiben, sein Ruf, seine Stimme: das ist der uns Menschen verständlichste Ausdruck im Reiche der Schöpfung.
Der nächtliche Sternenhimmel redet eine erhabene Sprache – ach, wie klein ist der Sterbliche doch, der andächtig zu den tausend und abertausend funkelnden Sonnen emporschaut! Das Meer braust heran, Woge auf Woge, ewig, gewaltig, unermeßlich, furchtbar im Sturm – eine Nußschale der riesige Dampfer, das Menschenleben ein Nichts. Der massige Fels erzählt uns seine Geschichte[9] aus nebelhaft grauer Vorzeit, wie ihn die bebende Erde gebar, wie Jahrmillionen ihn formten, auch das Unvergänglichste wandelnd – wer versteht seine Sprache, die uns allen so fremd ist! Der Krystall funkelt und gleißt, in spiegelblanken Flächen bricht sich das Licht – aber er spricht von starren, toten Gesetzen.
Nur das Leben redet zum Leben in lebendiger Sprache, in unsrer Sprache, in der Muttersprache, die allen eignet, die niemand erlernt, keiner zu erlernen braucht, die man nicht begreift mit dem Verstande, sondern die uns von Anfang an innewohnt, tief im fühlenden Herzen. Der Wald spricht mit uns, die einsame Wettertanne auf erhabener Felsenwacht, die Blume am Bachesrand, das flüsternde Schilf, die Heckenrose am Wege – aber: »Fleisch von unserm Fleisch und Bein von unserm Bein«, das gilt doch noch in weit höherem Grade von den Tieren, von unsern »Brüdern«, wie sie Goethe in jenem bekannten Wort an den »erhabenen Geist« nennt:
Die Sprache des Tieres, der Ausdruck seines Fühlens, seines Wollens ist unsrer Sprache verwandt; dem Tiere schreiben wir, wie uns selbst, eine Seele zu, die erkennt, die fürchtet und hofft, die liebt und haßt. Und wenn uns der Verstand auch immer wieder zuruft, daß das Geschöpf nicht anders handeln kann, als es handelt, daß es einem inneren Triebe folgt, einer Naturnotwendigkeit, und daß der Tierfreund in tausend Fällen die eignen Empfindungen und Gefühle erst in die Brust des Tieres hineinträgt und so das Tier bis zu gewissem[10] Grade vermenschlicht – warum, so frage ich, sollen wir das, was wir sehen, nicht in unsre Sprache übersetzen? warum sollen wir absichtlich den Eindruck zerstören, den eine sinnige Naturbetrachtung auf jedes unverdorbene Gemüt ausübt? Der strengen Wissenschaft mag ihr Recht bleiben, aber auch dem schlichten Naturfreund, der es im Verkehr mit seinen Lieblingen alltäglich erfährt, daß wenigstens das höhere Tier keineswegs eine bloße Maschine ist, ebensowenig wie der Mensch ein willenloses Rädchen im Uhrwerk des Weltgetriebes.
Zwischen unserm eignen Leben und dem Leben der höheren Tiere bestehen innere Beziehungen, die schon das Kind, ja dieses vielleicht noch mehr als der Erwachsene empfindet, und diese Fäden, die wir hinüberspinnen zu jedem beseelten Wesen, sie sind, wenn mich mein Naturempfinden nicht täuscht, die eigentliche, die tiefste Ursache für die hohe Bedeutung des Tieres im Landschaftsbild – ganz gleich, ob das Lebewesen durch seine Bewegung das Auge auf sich lenkt, ob es durch seine Färbung uns ergötzt, durch seine Stimme unsre Aufmerksamkeit fesselt, ob es einzeln auftritt und so den Eindruck der Einsamkeit verstärkt, oder ob ganze Scharen das Bild beleben.
Ach, wieviel würde uns fehlen, wenn wir durch unsern deutschen Frühlingswald gingen und kein Vöglein würde sein Lied anstimmen, kein Kuckucksruf, kein Trommeln der Spechte, wenn am Sommerabend kein Reh zur Äsung auf die Waldwiese oder das Kleefeld träte, wenn die bunten Falter nicht mehr über den Wiesenblumen gaukelten, am schilfbewachsenen Teich der Chor der Frösche für immer verstummt wäre, wenn die wandernden Vogelscharen nicht mehr am herbstlichen Himmel[11] gen Süden zögen, oder wieviel trauriger noch und öder unser nordischer Winter, wenn die schneebedeckten Felder und das Geäst des entblätterten Baumes nicht belebt wären von unsern gefiederten Freunden, die der Herrschaft des rauhen Gewalthabers trotzen!
Keine Klasse des Tierreichs vermag das Landschaftsbild auch nur annähernd so reizvoll zu beleben, wie die muntere Schar der Vögel. Der Flug durch die Lüfte – nicht an die Scholle gebunden wie Vierfüßler oder Kriechtiere, sondern frei und froh, Überwinder der irdischen Schwere – dazu die auffallende Stimme, von dem zweisilbigen Lockruf der Bachstelze oder dem einfachen Liedchen der Haubenlerche an bis zu dem seelenvollen Gesang der Nachtigall und dem jauchzenden Überschlag des Plattmönchs: das sind die Gaben, mit denen Mutter Natur ihre und unsre Lieblinge wie kein anderes ihrer Geschöpfe ausgezeichnet hat. Und durch diese beiden Eigenschaften tragen die Vögel an erster Stelle zur Belebung des Landschaftsbildes bei.
Der freie Flug! Fühlt nicht jeder das Walten der Schönheit, wenn die Möwenschwärme den meerumbrandeten Küstenfelsen umkreisen, wenn die Schwalbe niedrig über dem glitzernden Dorfteich dahinschießt, ihre Brust flüchtig ins Naß tauchend, um dann blitzschnell emporzusteigen, höher als die schlanken Pappeln am Uferrand, wenn die Dohlen das alte Gemäuer des Stadtturms umschwärmen, die Kiebitze über der feuchten Wiese ihre Flugkünste zeigen, wenn der Kuckuck falkenartig von einem Talhang zum andern hinüberwechselt,[12] die langschwänzige Elster wie ein Bolzen die Luft durchschneidet, oder der kleine Baumpieper von einem Ästchen aus schief emporsteigt und sich dann in schön geschwungenem Bogen wieder zu seinem Lieblingsplätzchen herabläßt!
Und erst der Raubvogel, der König der Lüfte! Ob es ein Adler ist, der stolz wie ein Flugzeug auf ausgebreiteten Schwingen ohne jede Bewegung durch den Luftozean gleitet, oder ein niedliches Fälkchen, das im Morgenglanz rüttelnd sein Spiel treibt, ein Wanderfalk, der in rasendem Flug seiner sicheren Beute nachstürzt, der mächtige »Auf«, der im Mondlicht lautlos durch sein Revier zieht, daß sein riesiger Schatten gespensterhaft über die Geröllhalden und die waldumgrenzte Gebirgswiese gleitet, oder nur ein Schleierkauz, der am dämmernden Abend weichen Flugs über dem Sturzacker schwebt: der Anblick jedes Raubvogels in der freien Natur löst in uns immer ein besonders starkes Gefühl aus. Vielleicht weniger – ich gebe es zu – weil das Malerische der Landschaft durch solch stolze Erscheinung gesteigert wird, als vielmehr aus dem Grunde, weil wir uns dabei bewußt werden, noch einen Ausschnitt, einen letzten Rest urwüchsiger Natur in unsrer leider so verarmten Heimat vor uns zu haben. Ein Flugzeug – ein Adler, hoch, hoch im weiten Himmelsraum: vielleicht ist der Anblick ganz ähnlich, aber die Wirkung auf den Beschauer, der zu beiden emporblickt, im tiefsten Grunde verschieden! Dort stolze Bewunderung, daß es dem Menschen gelungen ist, seinen Fuß von der Scholle zu lösen und sich ins Reich der Lüfte zu schwingen; hier edle Freude an reiner, starker Natur, ein Gottseidank, daß sie doch noch nicht völlig aus unserm Lande, aus unsrer Zeit[13] gewichen ist. Welcher Eindruck der stärkere ist, das hängt ganz vom Beschauer selbst ab.
Am sonnigen Frühlingsmorgen zwei Steinadler über der Ebene, aus der gegen Mittag die bayrischen Alpen aufsteigen. In schönen Spiralen schraubt sich das Paar höher und höher, ohne Flügelschlag einander umkreisend; bald schwebt dieser, bald jener über seinem Genossen. Den Hochzeitsreigen üben die mächtigen Vögel; er trägt sie in unermeßliche Höhen, daß sie dem Auge nur noch wie dunkle Punkte erscheinen. Schnell wie der Blitz dann herab; jetzt ruhiges Schweben, und jetzt so mächtiges Schlagen der stählernen Schwingen.
Vom Fels zum Meer! Auf niedriger Düne stehend, begrüß' ich die Ostsee. Nichts, nichts zu sehen als die unbegrenzte tiefgrüne See, deren weiße Wellenkämme in endloser Folge heranrollen, und der weite Himmel darüber – kein Dampfer, kein Segel. Schnurgerade streckt sich die Düne, mit Sandhafer nur dürftig bewachsen; hinter ihr Buchenwald und ein paar Strandkiefern. Eine einzelne Seeschwalbe, ein Krähenpaar, eine weiße Bachstelze am Strand – aber sie sind nicht imstande, das Gefühl der Einsamkeit und der endlosen Größe von Sand und Wasser zu mildern. Plötzlich ein Schrei, und gleich braust es heran, dicht über mir der gewaltige Seeadler. Er umkreist mich so niedrig, daß ich jede einzelne Schwinge, die goldgelben Augen, das spitze, weißliche Gefieder an Hals und Nacken, die orangefarbenen Fänge mit ihren schwarzen Krallen ganz deutlich erkenne. Weiß leuchtet der Stoß. Da, noch ein zweiter Adler, das etwas kleinere Männchen; mit hellem Schrei stürzt es herbei.
Ich bin in das Gebiet der Gewaltigen eingedrungen;[14] eine hohe Kiefer trägt ihren Horst. Wo ich auch stehe, die Adler umkreisen mich, immer aufgeregt schreiend. Schwerfälliger ist ihr Flug als der des Steinadlers, aber mächtig der Eindruck, mächtig und kraftvoll wie das Astwerk der noch blattlosen Buchen, wie die rotbraunen Stämme der uralten Föhren, gewaltig wie die Wogen der brausenden See: ein Bild urwüchsiger Kraft.
Auf der Seenplatte, die Norddeutschland von Ostpreußen bis Holstein durchzieht, haust noch ein anderer Adler. Nicht zu den Größten gehört er unter den Großen, aber er ist der Edelsten einer des edlen Geschlechtes. Ein herrlicher Anblick, wenn der Fischadler über seinen Jagdgründen schwebt! Kaum hebt sich am Morgen der wallende Nebel über dem dunkeln Waldsee, so erscheint, langsam die Fittiche schwingend, der stolze Fischer über seinem Jagdgrund! Er senkt sich in schöner Schraubenlinie herab und umkreist dann den See. Jetzt hemmt er den Flug; wie ein Falke hängt er im Luftraum. Einen Fisch hat sein Adlerauge entdeckt. Plötzlich, mit vorgestreckten Fängen stürzt er ins Wasser; aber noch ehe die Wellenkreise das nahe Ufer erreicht haben, erscheint der kühne Taucher schon wieder, den Flossenträger in den wehrhaften Klauen. Die Wassertropfen schüttelt er vom Gefieder; dann fliegt er heim nach seinem Horst. Still ruht wieder der Waldsee.
Soll ich noch weiter Bilder entwerfen von dem gaukelnden Spiel der Turmfalken über den Steilwänden und zwischen den Felsenzinnen der Talschlucht, von dem reißenden Flug des beutegierigen Sperbers, der vom Gehölz her mitten in die Schar der Feldsperlinge stürzt, daß sie die rettende Hecke kaum noch erreichen, von dem sanften, ruhigen Schweben hoch über der Flur[15] und noch höher über den Wipfeln des Waldes, wie es die Milane üben, der rote und der schwarzbraune, oder von dem lautlosen Dahingleiten der Rohrweihe, ganz niedrig über dem Schilf und dem im Sonnenstrahl glitzernden Wasser – wer nur einmal Zeuge solch eindrucksvoller Naturbilder ward, der denkt sein Lebtag daran.
Im Hochgebirge, wo die Felsenzinken zum tiefblauen Himmel emporstarren, in der Flachlandschaft, die den See grün umgibt, im Hochwald unsrer Mittelgebirge, oder draußen am Meeresgestade, wo die brandende Welle an den Klippen zerschellt: überall bildet die Erscheinung eines Raubvogels die wirkungsvollste Bereicherung des Landschaftsbildes, eine wertvolle Zugabe, die den Beschauer alles andere ringsum vergessen läßt.
Aber die Raubvögel sind nicht die einzigen Meister im Flug. Oft ist's die Wirkung der Massen, die zur Geltung kommt. Wie prächtig ist doch der Anblick eines nach Tausenden zählenden Schwarmes ziehender Stare im Herbste! Wahre Wolkenzüge, die fortwährend ihre Form ändern, bald breiter, bald schmäler werden, jetzt sich teilen und jetzt sich von neuem zu einem Riesenballe vereinen, der durch die Luft rollt. Oder der schier endlose Zug der Krähen, die in lockeren Gruppen am geröteten Abendhimmel nach ihren nächtlichen Ruheplätzen im Walde über der Schneelandschaft lautlos dahinstreichen – wie malerisch, wie stimmungsvoll dieser Anblick! Anders wieder der Zug der Kraniche, den man an hellen Herbsttagen bisweilen beobachten kann. Sie ziehen immer so, daß sie einen spitzen Winkel mit zwei ungleich langen Schenkeln bilden, jeder einzelne Vogel mit Hals und Beinen eine schnurgerade Linie[16] darstellend. Ein ganz eigentümliches Bild, diese zwei dunkeln, in einem Punkt sich vereinigenden Striche, wie sie am Herbsthimmel gen Süden stürmen, im Verein mit dem fallenden Laub, den abgeernteten Feldern, der letzten Rose im Garten von stärkstem Eindruck auf unser Gemüt. Werden wir sie wiedersehen, die Boten des Frühlings, noch einmal die lieblichen Bilder erleben, die in trüben Wintertagen die Sehnsucht nach dem erwachenden Lenz uns vor die Seele zaubert? – –
Wenn die grünen Spitzen der Saat aus der leichten Schneedecke hervorschauen, wenn das Schneeglöckchen sein Köpfchen erhebt und an den Ruten der Haseln die Kätzchen den Blütenstaub ausstreuen, dann begrüßt vor seinem Bretterhäuschen Freund Star den aufgehenden Sonnenball mit jauchzenden Rufen. Von den bereiften Ästen herab schwatzt der muntere Bursche seine bescheidenen Strophen hinein in den goldenen Morgen. Nicht genug kann er sich tun vor Freude und Lust: daheim, wieder daheim! Im schönsten Farbenschmuck, metallisch grün und tief purpurn läßt die Sonne sein dunkles, weißbetropftes Gefieder erscheinen: ein liebliches Stimmungsbild, das die selige Hoffnung auf den bald einziehenden Lenz weckt – »Frühling, Frühling wird es nun bald!«
Nur wenig Wochen, und die Lerche steigt am Ostermorgen zum Himmel empor, als wollte sie mit ihrem Siegesruf auch die fernsten Fernen des Weltalls erfüllen. Höher und höher flattert das kleine Vöglein über der lenzfrohen Saat, bis es schließlich unserm Auge entschwindet. Aber der Lobgesang, mit dem die Sängerin dort oben die ersten Sonnenstrahlen begrüßt, bleibt noch immer vernehmbar. Bald hallt der ganze Himmel wider[17] von den Jubelchören der singenden Lerchen. Nichts predigt so laut und eindringlich das Auferstehungsfest der Natur, wie das »melodisch gewirbelte Lied« der Lerchen, die hoch über dem sprossenden Grün oder dem samenauswerfenden Landmann, »im blauen Raum verloren«, jauchzen und jubilieren – ein Lied ohne Ende, »bei dem die Saaten lachen«.
Wohl ist das Auge der schärfste Sinn, aber die Pforte, die noch tiefer in unser Innerstes führt, noch unmittelbarer zu Herz und Gemüt, ist das Ohr. Und kein Zweifel, die Bedeutung der Vögel für das Landschaftsbild beruht noch weit mehr auf ihrer hervorragenden Stimmbegabung, als auf ihrer bloßen Erscheinung. Dabei wollen wir nicht nur an den jauchzenden Ruf der Singdrossel, an die Flötenstrophe ihrer Base, der Amsel, an Rotkehlchens sehnsuchtsvolles Lied, an die kecke Fanfare des Zaunkönigs oder an den unvergleichlichen Gesang der Nachtigall denken, sondern auch an andere anspruchslosere Lautäußerungen, zumal bisweilen ein einzelner Schrei oder ein ohrenbetäubendes Stimmengewirr, aber auch ein feiner Lockruf von der stärksten Wirkung ist und dem Landschaftsbild eine ganz bestimmte Färbung verleihen kann.
Vielleicht ist es nur Einbildung, nur eine schönklingende Redeweise, wenn man behauptet, eine Beziehung herstellen zu können zwischen den vielfältigen Stimmen der Natur und den verschiedenen Örtlichkeiten, die durch solche Lautäußerungen belebt werden, ein leeres Geschwätz, wenn man meint, der Lobgesang der[18] Lerchen stimme zu der Frühlingssaat, da unaussprechlich innige Seufzen und Schluchzen der Philomele zu dem nächtlich dunkeln Gebüsch am Rande des Weihers; nur zu der Meereswoge, vom heulenden Sturm gegen die Klippen gepeitscht, passe der heisere Schrei der Möwe, und zu dem nächtlichen Hochwald der unheimliche Eulenruf; der liebliche Gesang des Rotkehlchens gehöre in den lichten, maiengrünen Laubwald und das Schackern der Elster auf die beschneite Flur. Möglich, daß Vogelstimme und Örtlichkeit wirklich nichts miteinander zu tun haben, obgleich ich darauf hinweisen könnte, wie z. B. der Lehrmeister der Wasseramsel ohne Zweifel das auf steinigem Grunde dahinplätschernde Gebirgsbächlein gewesen ist, mit dessen leisem Rieseln der Gesang des am Wasser aufgewachsenen Vogels verglichen werden kann, wie das bunte Allerlei der quecksilbernen Rohrsänger in seiner ganzen Färbung etwas vom Froschkonzert und vom Gurgeln des Wassers am unterwaschenen Uferrand hat; aber angenommen auch, es seien nur liebe Erinnerungsbilder – das jungbelaubte Eichen- oder Buchenwäldchen im Talgrund, das beim Pirolruf vor unsrer Seele auftaucht, der schneebedeckte Fichtenbestand, den die Strophe des Kreuzschnabels uns vorzaubert – soviel steht jedenfalls fest, daß unsre Einbildung, diese oder jene örtlichen und zeitlichen Verhältnisse harmonierten mit ganz bestimmten Vogelstimmen, durchaus lebendig ist und täglich neue Nahrung empfängt. Wo wir aber Harmonie empfinden, empfinden wir Schönheit. Nicht darauf kommt's an, ob solcher Einklang wirklich besteht, ob der Verstand ihn ablehnt oder begründet, sondern allein auf unsre Empfindung.
Nur ein paar Beispiele, die den tiefen Eindruck der Vogelstimmen auf unser Gemüt weit besser erläutern als viele Worte.
Den Ruf der Wachtel kennt jeder, und jedermann liebt ihn. Und doch anmutig und lieblich kann man ihn kaum nennen. Dazu ist er zu kurz und namentlich zu hart abgebrochen, in der Nähe sogar ziemlich gellend und scharf. Nur aus drei Silben besteht der Ruf, ein Daktylus, der stets wiederholt wird. Wie erklärt sich also der nachhaltige Eindruck des Wachtelschlags und unsere Vorliebe für ihn? Die Stimmung, die Färbung der ganzen Umgebung, das ist die Lösung des Rätsels.
Dem rastlosen Treiben der Stadt haben wir den Rücken gekehrt, der drückenden Schwüle in den staubigen Straßen sind wir entflohen. Die heiße Sommersonne ist untergegangen, ein erfrischender Abendhauch weht aus dem Saatgefilde. Vor uns das Dorf, in blaue Dämmerung gehüllt: ein Bild des Friedens. Der Lerche bunte Lieder sind verstummt; nur das gleichmäßige Zirpen der Grillen zittert einschläfernd durch die weite Flur. Das blühende Weizenfeld hat sich dem Schlaf überlassen; wie im Traum nickt die geschlossene Blüte des Mohns, und nur ein paar Abendfalter taumeln über der ruhenden Flur. Da steigt der Mond am östlichen Himmel auf, und nun tönt es vom Rande des Feldes »pickwerwick, pickwerwick,« zehn- oder zwölfmal, dann eine Pause. Eine zweite Wachtel gibt Antwort; in der Ferne schlägt eine dritte, und je mehr sich die Mitternacht nähert, um so hitziger schallt es. Erst in den frühesten Morgenstunden verstummt allmählich der muntere Schlag. Wenn aber dann der junge Tag den nordöstlichen Himmel zu[20] röten beginnt, tönt es wieder gar eifrig durchs ganze Gelände, das freundliche »Pickwerwick«, und die ersten Lerchen in der Höhe stimmen mit ein in den Gesang des Feldes tief unter ihnen.
Schade, ewig schade, daß die vielen Wachteln, deren Schlag mich in meinen Jugendtagen zur Sommerszeit allabendlich erfreute, bis auf einzelne Ausnahmen in meiner Heimat verschwunden sind. Unersetzliche Stimmungswerte sind mit ihnen verloren gegangen; die friedlichen Feierabende des Dorfs haben eine schwere Einbuße erlitten, und das Leben des Landmanns ist ärmer geworden.
Von stärkster Wirkung ist auch der Eulenruf. An sich unschön, ja häßlich, heulend und schreckhaft; aber wir glauben gleichfalls eine Harmonie mit Zeit und Ort zu fühlen, und so dürfen wir auch hier von einer ästhetischen Bedeutung solch seltsamer Lautäußerungen sprechen.
Der nächtliche Wald oder das einsame zerfallene Gemäuer weckt die Einbildungskraft, so daß auch der nüchternste Mensch sich nur schwer eines gewissen Grauens erwehren kann. Aus jedem größeren Wald, selbst aus manchem Park erschallt um die Zeit von Frühlings Tag- und Nachtgleiche der Ruf des Waldkauzes; oft wiederholt klingt er wie heulendes Hohngelächter. Was ist dieser Ruf aber gegen das schauerlich widerhallende »Buhu« des mächtigen »Aufs«, das der König der Nacht zur Paarungszeit fast ununterbrochen hören läßt. Wer in uhureicher Gegend, z. B. in den Waldgebirgen Bosniens nur einmal eine mondhelle Nacht erlebt hat, wird es begreifen, daß der Uhuruf im Aberglauben, in Märchen und Sagen eine große Rolle spielt. Unheimlich klifft[21] und klafft es, heult und wiehert, lacht und jauchzt es durch den dunklen Gebirgswald.
In unsrer engeren Heimat finden sich die weitaus größten Vogelgesellschaften an den Teichen und Seen der Lausitz. Sie verleihen dem Landschaftsbild zu allen Jahreszeiten einen ganz besonderen Reiz, an dem sich Auge und Ohr des Naturfreundes immer von neuem ergötzen.
Schon aus der Ferne vernimmt man im zeitigen Frühling, wenn kaum die ersten grünen Spitzchen des jungen Schilfs über der Wasserfläche hervorschauen, ein vieltöniges Stimmengewirr. Enten der verschiedensten Art schreien und quälen; die Kiebitze, die eben von der Reise zurück sind und von denen einige uns umgaukeln, seltsamen, wuchtelnden Flugs, stoßen ihre zweisilbigen Klagerufe aus; Bläßhühner lassen ihre scharfe Lockstimme hören; mit tiefem »grök grök« melden sich die großen Haubentaucher, während ihre kleinen Vettern, die niedlichen Zwergtaucher, hell kichern und trillern, die Rothalstaucher aber, die lautesten ihrer Sippe, seltsam grunzen und quieken, daß man's weithin hört von einem Teich zu dem andern. Lachmöwen sind auch schon da; unruhig flattern sie durch die Luft. Aber noch vielmehr mögen sich in jener Bucht verbergen, die das abgestorbene Schilf unsern Blicken entzieht; denn hundertfach tönt das nimmermüde »Krrriäh« aus dem geschützten Winkel.
Wenn aber in ein paar Wochen Drossel- und Teichrohrsänger von der Reise zurück sein werden, dann geht's noch viel lauter zu; dann hat diese kleine quecksilberne Sängergesellschaft das Wort; »karrakiet, karrakiet,« den ganzen Tag fast, besonders am frühesten Morgen und am Abend bis spät in die Nacht. Kaum zur Geisterstunde[22] gönnt man sich eine Pause. Es ist, als wollten sie wetteifern mit dem Gequak und Geknarr der Froschsänger, deren Stimmen die ganze Frühlingsnacht nicht müde werden.
Und nun treten wir durch das Röhricht ans Ufer. Da schwimmt es auf dem Gewässer, flattert empor, taucht unter, rennt flügelschlagend über den Wasserspiegel oder segelt hoch in der Luft. Lachmöwen wirbeln umher wie riesige Schneeflocken oder ruhen, weißen Seerosen zu vergleichen, in der lauschigen Bucht, die sie sich zur Brutstätte erkoren haben; einzelne Trauerseeschwalben schießen durch die Luft; Rotschenkel ziehen, unermüdlich rufend, ihre Kreise; hinter der Ente flattert der Erpel von einem Teich zu dem andern: Taucher und Tauchenten üben ihre Kunst: weg sind sie, mit einemmal verschwunden, um dann an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Das grünfüßige Teichhühnchen macht seinem Weibchen den Hof; weißstirnige »Blässen« schlagen mit ihren Lappenfüßen das Wasser; neue Ankömmlinge – kleine Krikenten sind es – brausen mit seltsam schwingenden Flugtönen herbei, und ein paar Rothalsmännchen bekämpfen einander, bellende und quiekende eifersüchtige Kriegsgesänge ausstoßend. In der Tat, ich kann mir einen solchen Flachlandsee meiner Heimat kaum denken ohne das bunte, vielgestaltige Leben seiner gefiederten Bewohner, und ich weiß nicht zu entscheiden, ob es das Auge ist oder das Ohr, durch dessen Vermittlung uns dieses nimmermüde Treiben wirkungsvoller zum Bewußtsein kommt. Ach, wie wäre solch Teich- oder Seenlandschaft unsrer Heimat mit einem Schlage all ihres Reizes bar, wenn ihr plötzlich dies reiche Leben geraubt würde!
Und diese Gefahr liegt vielleicht nicht so fern, wie die meisten wohl glauben. Die Entenscharen haben schon hie und da in erschreckender Weise abgenommen; wie viele Lachmöwenkolonien sind bereits völlig verschwunden, wie viele in den letzten Jahrzehnten kleiner und kleiner geworden! Nicht ein einziges Reiherpaar horstet mehr auf sächsischem Boden, und der merkwürdigste Vogel unsrer Lausitzer Seenlandschaft, die große Rohrdommel, ist auch bereits so selten geworden, daß man sie für Sachsen heute schon als ein Naturdenkmal bezeichnen muß. Und gerade das tiefe »Prumb«, das dieser reiherartige Vogel in der Stille der Nacht ausstößt, daß man's wohl eine halbe Wegstunde weit hört, ist wie der Uhuruf im Hochwald oder das Orgeln und Röhren des Platzhirschs im Herbst von allergrößter Wirkung. Seltsam hört sich's an, und manches abergläubische Männlein und Weiblein meint, ein Gespenst treibe auf der schilfbewachsenen Insel im Teich sein unheimliches Wesen.
Auch Instrumentalmusik wird von einigen Vögeln geübt. Da sind zunächst die Spechte zu nennen. Ihr ganzes Dasein, von der Wiege bis zur Bahre, steht in innigster Beziehung zum Holz. Kein Wunder also, daß sich ihre musikalische Betätigung von Anfang an dem Xylophon zugewandt hat; sie spielen es meisterhaft. Man soll nur versuchen, es ihnen nachzumachen, man bringt's nicht. Unser Trommeln auf irgendeinen dürren Ast bleibt Stümperei gegenüber dem kräftigen Schnurren, wie es besonders der Schwarzspecht, aber auch die kleineren Buntspechte üben. Sobald der trommelnde Specht nach einem andern Baumzacken fliegt und mit seinem Instrument wechselt, gleich gibt's einen andern,[24] d. h. höheren oder tieferen Ton. Dieses Lied ohne Worte ist auch ein Liebeslied. Es paßt zu der ganzen seligen Frühlingsstimmung im Wald und im Park und in der lenzgrünen Au, es paßt zu dem ersten Kuckucksruf und zu dem liebeflehenden Gurren der Wildtaube, zum süßen Lied des Fitis, wie zum kecken Reiterstückchen des Buchfinken. Den Frühlingstagen in der sonnigen Heide würde ein eigener Reiz fehlen, wenn sich die gefiederten Trommler nicht mehr hören ließen.
Und nun unsre Störche. Kein Vogel vermag dem Dorfbild so viel Stimmung und Reiz zu verleihen wie Adebar, unser Langbein; selbst die lieblichen Schwalben, deren Flug und Gezwitscher das Dorf so anmutig beleben, müssen in dieser Beziehung hinter ihm zurücktreten. Sie sind die Schützlinge jedes einzelnen Gehöfts, der Storch aber ist der Freund der ganzen Gemeinde, gewissermaßen ihr Vertreter innerhalb der gefiederten Welt. Ich bin so froh, daß wir in der sächsischen Lausitz noch eine kleine Anzahl besetzter Storchnester haben. Ist's nicht ein hübsches, gemütliches Bild, wenn die Störche kurz vor Sonnenuntergang zu ihrem Horst heimkehren und nun am First der strohgedeckten Scheune stehen, wo sie sich so gut vom geröteten Abendhimmel abheben! Jetzt vernimmt man auch ihr seltsames Klappern. Es klingt nicht schöner, als wenn ein Stock schnell über einen hölzernen Zaun hinfährt; aber Poesie ist's doch, Dorfpoesie, wie das Mühlengeklapper, das Dengeln der Sense, das Klipp-klapp der Dreschflegel auf harter Tenne. Urgemütlich hallt es von der Höhe herab durch die ganze Gemeinde zu jedermanns Freude. Wer es nicht fühlt, daß das Klappern der Störche mehr ist, als bloßes Geräusch, der hat keinen Sinn für die Reize des[25] Landlebens, kein Verständnis für das friedliche Dorfbild des Niederlandes, ja es fehlt ihm die rechte Liebe zur Heimat.
Viel geringer in ihrer Bedeutung für das Landschaftsbild sind die hübschen Farben und Zeichnungen des Vogelkleides. Mutter Natur handelt gar fürsorglich; sie hat ihre Lieblinge so ausgestattet, daß selbst ein bunter Vogel, wenn er ruht, nicht besonders auffällt. Der weiße Bürzel des Eichelhähers oder der Hausschwalbe, der goldgelbe des Grünspechts, das Weiß und Schwarz der Kiebitze, selbst das buntschillernde Gewand des Eisvogels, das tropische Farbenkleid der Blaurake oder des Pirols: das alles kommt doch erst während des Flugs zur Geltung. Die Bewegung bleibt immer die Hauptsache.
Wie ein leuchtender Funken schießt der Eisvogel an uns vorüber, metallisch grün und seidig blau, ein blitzender Edelstein von unvergleichlicher Schönheit. Besonders in der Winterlandschaft, wenn der Gebirgsbach das schimmernde Eis, das ihn einzwängen will, mit weißem Gischt überschäumt und das Licht sich in den glänzenden Schneekristallen tausendfach bricht, dann ist der wunderbare Vogel eine geradezu märchenhafte, ich möchte sagen überirdische Erscheinung. Ist's Wirklichkeit oder ist es ein Traum, der unser Auge getäuscht hat?
Eine prächtige Zierde des winterlichen Waldes sind auch die Kreuzschnäbel, nordische Gäste, die uns freilich nicht in jedem Jahre reichlich besuchen. Ihr Kleid ist wundervoll johannisbeerfarben. Wenn auf[26] jedem Zweig dichter Schnee liegt und nur hie und da zwischen dem reinen Weiß die schwarzgrünen Nadeln hervorschauen, dann kann man sich an dem Farbenreiz der kleinen roten Geschöpfe, wie sie an den Spitzen der Ästchen oder an den Zapfen herumklettern, nicht satt sehen. Natürlich wird die Wirkung der Farbe erhöht, wenn die geselligen Vögel in möglichst großer Zahl auftreten. Denn der einzelne dieser kleinen Gesellschaft ist ja nur ein Punkt in dem weiten Landschaftsbild; es müssen sich schon mehrere zu einem bunten Fleck vereinigen, ehe von einer Farbenwirkung gesprochen werden kann. Und Sonne gehört dazu, strahlende Sonne!
Ist's bei den Blumen nicht ebenso? Die einzelne Blüte des Mohns, des Windröschens, der Dotterblume, selbst ein einzelner Busch des blühenden Heidestrauchs, der Schlehe, des Ginsters geht trotz aller Farbenpracht in dem großen Gemälde verloren. Viele tausend gleichartige Blumen sind dazu nötig, auf der Wiese gelbe oder blaue Flecken zu malen, den Schlehdorn, den Obstbaum in duftigen Schnee zu hüllen, der sandigen Heide im Spätsommer das lichtviolette Kleid zu weben, den Berghang in Gelb oder Rosa zu tauchen, und nur wenn wir ganz nah an ein enger begrenztes Bild herantreten, da genügen auch einzelne Blumen, einen farbigen Eindruck hervorzurufen: ein paar Rosen am Gartenhaus, feurige Mohnblumen am Feldrain oder ein paar Schwertlilien am kleinen schilfumgrenzten Weiher.
Aber gerade den farbenprächtigsten Vögeln begegnet man nur selten in größerer Anzahl, wenigstens in unserer Heimat. Ich entsinne mich nur ein einziges Mal einen Trupp von zwölf oder fünfzehn Pirolen angetroffen zu haben. Sie flogen zwischen den Pappelreihen[27] der Straße eine lange Strecke vor meinem Wagen her; dabei setzten sie sich in regelmäßigen Zwischenräumen auf die Bäume und warteten, bis das Gefährt herankam, um dann wogenden Flugs wieder voranzueilen. Ein bezaubernder Anblick war's, wie das goldgelbe Kleid dieser Vögel abwechselnd aufblitzte und verlöschte, je nachdem das grelle Sonnenlicht sie umflutete oder die schwarzen Schatten der hohen Pappeln auf sie fielen. Also auch hier Hand in Hand Bewegung und Farbe.
Bei der bunten Mandelkrähe habe ich einmal in der Lausitz ganz Ähnliches erlebt; aber es waren nur vier oder fünf, die mich durch die sandige Heide ein gut Stück begleiteten.
Im Gesamtbild der Landschaft tut's immer erst die Masse, und in dieser Beziehung wüßte ich keinen Vogel zu nennen, dessen Farbenkleid seinem Aufenthaltsort so zum Schmucke gereicht, wie der weiten Wasserfläche die schneeige Lachmöwe mit ihrem zartblauen Mantel. Den vollen Genuß gewährt aber auch hier erst die Bewegung, wenn die langflügligen Vögel zu Hunderten in der Luft wirbeln und ihre kreischenden Stimmen hören lassen. An der Meeresküste übertönen die Sturm- oder die Silbermöwen selbst die Wogen der brandenden See, so laut diese auch gegen die Klippen krachen und donnern. Wenn irgendein Vogel das Geschöpf einer bestimmten Landschaft genannt werden kann, so ist es die Möwe. Der Sturm hat ihr die bangen Armknochen und die starken Schäfte der Schwingen gegeben; die See hat die Ruder gebildet von höchster Vollendung: der kurze Lauf, seitlich zusammengedrückt, und Schwimmhäute zwischen den Zehen. Das Blau des Himmels, an dem[28] die weißen Wolken dahinziehen, das Blau der See, mit dem Weiß der Wellenkämme geschmückt: die Möwe trägt die gleichen Farben auf ihrem Kleid. »Flatternd schwebt sie am Himmel, dicht fliegt sie über den Wellen; den lichten Seglern folgt sie hinaus übers Meer, mit den Wolken zieht sie ins Land. Wo ein See oder Teich des Himmels Bläue mit den schneeweißen Wolken wiederspiegelt, da erkennt sie die Heimat – die Mutter ist's, das unendliche Meer, das blauen Auges emporschaut – wo ein Schiff auf dem Rücken des Stromes langsam dahinzieht, da flattert die Möwe: Grüß mir das Meer und die felsigen Klippen am Strand und die Brandung im Sturm.« (Aus des Verf.s Abhandlung über die Möwen in den »Lebensbildern aus der Tierwelt«, R. Voigtländers Verlag.)
An Farbenpracht ihrer Geschöpfe wird unsre nördliche Heimat von südlicheren Zonen weit übertroffen. Man hat deshalb wiederholt versucht, diesem Mangel etwas abzuhelfen, indem man sich Mühe gab, fremdländische Vögel in Deutschland einzubürgern. Jäger und übereifrige Vogelfreunde nahmen sich der Sache an. Jene wollten sich in ihrer Lust an Hege und Jagd nicht genügen lassen mit unsern Feld- und Waldhühnern, mit Enten und andern Wasservögeln; diese dachten sich's so schön, die Farbenpracht fremder Zonen in unsre Parks, Gärten und Wälder zu verpflanzen. Beides Versuche, gegen die sich glücklicherweise die Natur selbst wehrt. Nur eine einzige Vogelart hat sich wirklich dankbar gezeigt, der Fasan, dessen Einbürgerung restlos gelungen ist, obgleich nicht nur das Prachtgefieder, sondern auch das ganze Gebaren des Tieres den Fremdling noch immer auf den ersten Blick verrät. Dagegen sind Schopf- und[29] Baumwachtel, Rot- und Moorhuhn sehr bald wieder von der Bildfläche verschwunden, ebenso der amerikanische Wildputer. Und von den chinesischen Nachtigallen, Papageien, roten Kardinälen und andern Ausländern hat man nicht selten an dem Tage, da man sie aussetzte, das letzte bunte Federchen gesehen. Und das ist gut so. Diese Fremdlinge passen ebensowenig in die heimatliche Landschaft, wie Weymouthskiefer, Roßkastanie, Robinie, amerikanische Eiche in den deutschen Wald, während man in Gärten und Parks sich diese fremdländischen Bäume wohl kann gefallen lassen.
Anders das zahme Hofgeflügel, das ja, soweit es, zur artenreichen Familie der Hühner gehört, gleichfalls fremdländischen Ursprungs ist. Hier handelt es sich um Genossen des Menschen, die seine Wohnstätte mit ihm teilen und dieser tatsächlich zu hoher Zierde gereichen; zur freien, unberührten Natur aber würden sie gleichfalls im Widerspruch stehen. Einen Bauernhof, und sei er noch so klein, ohne die muntere Schar der Hühner, geführt vom farbenprächtigen Hahn, kann man sich ebensowenig denken, wie das herrschaftliche Gut ohne den kollernden Puter mit seinen Hennen, und wenn auf der Freitreppe vor dem Schloß der Pfau sein glänzendes Rad schlägt, so paßt solche Farbenpracht recht wohl zu dem Reichtum, von dem das Bild zu uns spricht. Tot ist die Dorfstraße, wenn nicht schillernde und buntscheckige Hühner umhertrippeln oder an den Hoftoren in den flachen Löchern ruhen, die sie sich im Schatten des blühenden Hollers ausgescharrt haben. Wie anmutig auch der Blick in die Höhe, wenn die Tauben ihre Flugkünste zeigen, in weiten schön geschwungenen Bogen die ganze Ortschaft umfliegend, bald sich trennen, bald sich[30] wieder vereinen, um sich endlich flatternd auf dem Dach niederzulassen, unter dem sie wohnen.
Auch unser zahmes Wassergeflügel, dessen Stammväter und -mütter bei uns Heimatrecht genießen, die Gänse und Enten und vor allem die Schwäne, sind recht wohl imstande, das Landschaftsbild aufs reizvollste zu beleben. Die Enten am Bach oder Dorfteich – ach, wie gemütlich ihr eifriges Schnattern – die Gänseherde, die durch das Gras zieht, militärisch in langer Reihe, aber watschelnden Ganges, der stolze Schwan, gleich einem Schiff mit geblähten Segeln über den Spiegel des Schloßteichs gleitend: man erfreut sich doch immer wieder an solchem Anblick, so oft man's auch schon geschaut hat.
Hinter dem Vogel bleiben alle andern Tiere in ihrer Bedeutung für das Landschaftsbild weit zurück. Namentlich gilt das von den Säugetieren, in erster Reihe von den wildlebenden. Mäuse auf dem Felde, niedliche Spitzmäuse zwischen dem herbstlichen Buchenlaub am Boden, ein Wiesel, ein Igel – von einer Bereicherung des Landschaftsbildes kann man bei ihnen kaum sprechen, nicht einmal wenn ein paar Jungfüchse oder Karnickel vor ihrem Bau spielen, oder wenn Freund Lampe Fersengeld gibt, daß seine weiße Blume bei jedem Sprung im Krautacker hell aufleuchtet wie ein Fetzen Papier, mit dem der Wind sein lustiges Spiel treibt.
Mit mehr Berechtigung könnten wir schon das muntere Eichhorn anführen, an dessen Kletterkünsten alt und jung sich erfreut. Man kann dem netten, zierlichen[31] Tierchen kaum gram sein, obgleich es viele Untugenden hat; wo es dem deutschen Walde fehlt, da vermissen wir's ungern. Auch die Fledermäuse beleben den dämmernden Abend, der sich über die Flußlandschaft senkt, in eigenartiger Weise. Viele Freunde haben sie nicht unter den Menschen, und doch im Vorfrühling ist mir die erste Fledermaus, die sich aus dem Winterversteck gewagt hat und deren Zickzackflug sich so seltsam vom geröteten Abendhimmel abhebt, eine gar liebe Erscheinung, ein Frühlingsbote, den ich ebenso freudig begrüße, wie den ersten Zitronenfalter, den ersten Flötenruf der Amsel, das erste Quaken der Frösche.
Von den wildlebenden Säugetieren kommt eigentlich nur das Hochwild für das Landschaftsbild in Betracht: Rot- und Rehwild, in manchem Herrschaftspark Damwild, weiter das Schwarzwild und im Hochgebirge das Krickelwild. Ein schmucker Sechserbock im Buchenwalde, mit dem geperlten Gehörn zwischen den Lauschern, wie er erhobenen Kopfes verhofft, um dann in weiten Fluchten leichtfüßig über Stock und Stein zu setzen, eine Ricke mit ihrem Kitzchen auf der Waldwiese äsend, Rotwild, das gegen Abend aus dem Dunkel des Hochwaldes tritt, oder halbzahmes Damwild, das sich im Schloßpark unter dem Schatten mächtiger Baumriesen gelagert hat: liebliche Bilder sind es, die keineswegs nur das Herz des Jägers entzücken, sondern jeden erfreuen, der im Verkehr mit der Natur Genuß und Befriedigung findet. Und wenn im Herbst der Brunfthirsch orgelt und schreit, in der Dämmerung abends oder frühmorgens, daß es dröhnend und röchelnd über die Waldblöße schallt, ich glaube, es kann sich niemand des Eindrucks solcher Laute entziehen. Ein Stück[32] ursprünglicher, unverdorbener Natur tritt uns in ihnen entgegen, um so wertvoller, je seltener wir Großstadtmenschen uns dem unmittelbaren Verkehr mit der Natur hingeben können. Dankbar erkennen wir's dann an, daß allein einem streng durchgeführten Jagdschutz solch erhebende Stimmungsbilder auf unserm heimatlichen Boden zu verdanken sind. Der Uhuruf ist in unsern sächsischen Gebirgswäldern verhallt; möge nie die Zeit kommen, wo man nicht mehr den Schrei des Brunfthirsches vernimmt, der seinen Gegner zum Zweikampf fordert! Ein gut Stück urwüchsigen Waldeszaubers wäre für immer dahin.
Wie ein Recke aus vergangenen Tagen mutet uns das Wildschwein an. Seine ganze Erscheinung hat gewiß wenig Anziehendes an sich; ein rauher, borstiger Geselle ist solch ein Keiler, und auch sie, die Bache, ist eine ungemütliche Dame, aller Anmut, jedes Reizes bar. Aber im Winter, wenn der Forst tief verschneit ist und das Leben erstorben scheint, bis auf ein paar Krähen, die sich mit heiserem Schrei im Wipfel der hohen Föhren einschwingen, daß der Schnee, einer leichten Staubwolke gleich, dahinfliegt, dann vermögen zwei oder drei »Schwarzkittel« der Landschaft eine Stimmung von außerordentlicher Stärke zu verleihen. Die gedrungenen dunkeln Gestalten heben sich so gut von der weißen Schneedecke ab. Dampf hüllt sie ein, Rauhreif deckt ihr borstiges Kleid, und am Rüssel haftet der Schnee bis hinauf zu den Sehern. Sie verachten den eisbärtigen Herrscher des Nordens, der ihnen nichts anhaben kann; unter dem Schnee wühlen sie doch ihre Nahrung hervor. Selbst die härteste Schneekruste, die das Reh laufkrank macht, daß es leicht dem Fuchse zur Beute fällt, brechen sie auf, und[33] die Kälte fürchten sie noch weniger; denn sie haben sich im Herbst, dank der Eichel- und Buchelmast, feist herangefressen.
Im Hochgebirge ist es die Gemse, welche die nackten Felsengrate und Steintrümmermeere, die Steilhänge und die höchsten Alpenmatten reizvoll belebt. Wem nur einmal das Glück geworden ist, vielleicht am frühen Morgen ein Rudel zu belauschen, das seinen Durst an dem schwarzblauen, goldumränderten Meerauge tief unten im starren Felsenzirkus löscht und dann den Menschen bemerkt und erschrickt – hei! wie schnell geht's in dem harten Gestein hinauf bis zum zackigen Grat, hinter dem eins nach dem andern verschwindet – der vergißt's sein Lebtag nicht wieder.
Im Gewänd kletternde Hausziegen mögen, aus weiter Ferne gesehen, einen ganz ähnlichen Anblick gewähren, wie ruhig äsendes Krickelwild, und so mancher Alpenbesucher, der nur das friedliche Haustier beobachtete, wird in dem Wahn, er habe Gemsen belauscht, hochbefriedigt aus den Bergen heimkehren. Gewiß, die äußere Erscheinung bietet viel Ähnliches, aber der Gefühlswert ist in beiden Fällen doch ganz verschieden. Dort ein Tier der freien Natur, hier ein vom Menschen abhängiges Geschöpf; dort Freiheit und Ursprünglichkeit, hier Zwang und Kultur. Wie grundverschieden die Stimmungen, die solcher Gegensatz im Beschauer auslöst! Wir sehen ja nicht nur mit unserm leiblichen Auge, sondern zugleich mit einem inneren Sinn. Damit soll jedoch nicht geleugnet werden, daß auch unsern vierfüßigen Haustieren eine große Bedeutung für das Landschaftsbild zukommt. Tausend Gemälde älterer und neuerer Maler führen es uns immer wieder vor Augen.
Wir brauchen nur an die buntscheckigen Rinder zu denken, die auf dem grünen sonnigen Plan weiden oder wiederkäuend im Schatten hoher Bäume ruhen, an die blökende Schafherde, die langsam am Berghange hinzieht, an die munteren Fohlen, die sich in der Koppel nach Herzenslust tummeln: anmutige Bilder, die den Frieden des Landlebens atmen. Aber selbst ein einzelnes Tier, ein einzelnes Gefährt kann der Landschaft einen bestimmten Stimmungsgehalt geben: der breitstirnige Stier vor dem Pflug, wie der Postwagen auf der Landstraße.
Den kaltblütigen Wirbeltieren, also Kriechtieren, Lurchen und Fischen, brauchen wir kaum unsre Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr verstecktes Leben bringt es mit sich, daß sie auf das Landschaftsbild nicht bestimmend einwirken, wobei ich jedoch nicht leugnen will, daß kleine Ausschnitte der Landschaft, z. B. ein Tümpel im verlassenen Steinbruch durch Tritonen und Salamander, ein steiniger Hang durch schnelle Eidechsen, ein Gebirgssee oder ein Waldbach durch die hübsch gepunkteten, flinken Forellen, die hie und da emporschnellen, um nach Insekten zu schnappen, an Reiz gewinnt.
Aber in einer Hinsicht spielen doch auch ein paar Amphibien keine ganz unwichtige Rolle. Ich meine gewisse Froschlurche, den Wasserfrosch, den Laubfrosch und die Unke, deren Einzel- oder Chorgesang weithin durch die stille Landschaft schallt. Wenn wir auf der Stufenleiter der Tiere aufwärts steigen, so sind es diese Lurche, bei denen wir zuerst einer wirklichen Vokalmusik begegnen,[35] einer Lautäußerung durch die Stimme, dem Uranfang einer Sprache. Alle andern tiefer stehenden Tiere, namentlich die Insekten, üben höchstens Instrumentalmusik aus1; der Frosch aber ist der erste Sänger. Kraftvoll versteht er seine Stimme zu gebrauchen; bestimmte melodische Sätze wechseln und kehren in regelmäßiger Folge wieder, und sein angeborenes Gefühl für die Zeitmaße ist hervorragend, man muß es ihm lassen.
1 Wenn man auch bei den brummenden und summenden Insekten, den Bienen, Hummeln, Fliegen u. a., von Stimmorganen, wenn man vom »Singen« der Mücken redet, so ist nicht viel dagegen einzuwenden; denn in der Tat werden solche Lautäußerungen mit Hilfe der Atemluft hervorgerufen, die durch die Atemlöcher, die sog. »Stigmen« streicht. Aber die Art der Insektenatmung ist doch eine ganz andere, als die der höheren Tiere, bei denen die Stimmbildung in der Hauptsache der Luftröhre und dem Kehlkopf zukommt.
Ein lauwarmer Frühlingsabend hat sich über den schilfumsäumten Teich gesenkt. Wir sind ans Ufer getreten. Die Frösche, deren Chorgesang uns aus der Ferne entgegenschallte, schweigen jetzt, vergrämt durch die leisen Erschütterungen des Bodens infolge unserer Tritte. Nur die Wellen glucksen am Uferrand, und leise flüstert das Schilf im Abendhauche. Die Rohrsänger sind es, die zuerst die feierliche Stille unterbrechen: schnarrende, quietschende, pfeifende Töne, ein buntes Durcheinander, aber immer im Takt. Horch, jetzt auch ein paar gurgelnde Laute aus der Tiefe des Schilfs: »gluck, gluck«, und zwei oder drei knarrende Töne: »koax, koax«. Bald wagen's auch andere, hohe Tenöre und tiefe Baßstimmen, trillernd und volltönend, bis sich die ganze Gesellschaft an diesem Singsang beteiligt: »brekeke koax, brekekeke, tuu tuu«. Je mehr der Mond, der hinter den alten Weiden auftaucht, sein volles Licht über den Teich ergießt, um[36] so eifriger schallt es: Frösche und Rohrsänger im Wettgesang, daß es weithin schallt über die schlafende Flur. Die Motive verschieden, die Stimmen höher und tiefer in seltsam wechselnden Sprüngen hinauf und hinab, ein musikalischer Mischmasch; aber es paßt alles zusammen, zumal das ganze Konzert von einem streng innegehaltenen Rhythmus beherrscht wird. Dieser wird noch besonders dadurch betont, daß einzelne Sängergruppen auf einmal ein Weilchen schweigen, um dann mit voller Kraft wieder einzufallen. Jetzt singt es hier, jetzt da; bald knarrt und quakt nur eine kleine Gesellschaft noch, bald singt wieder der ganze Chor, als sollte er das Versäumte nachholen. Solches Ab- und Anschwellen wirkt besonders in größerer Entfernung recht auffallend; es ist, als ob uns der Nachtwind bald mehr, bald weniger Tonwellen zutrüge, ein rhythmischer Wechsel, der den Reiz des Froschkonzerts wesentlich erhöht.
Fleißigere Sänger gibt's nicht, als Rohrsänger und Frösche. Selbst die Nachtigall macht 'mal eine längere Pause zu mitternächtiger Stunde; der Nachtschwalbe »Spinnen« schweigt mitunter ein Weilchen, und auch die verliebten Käuze im Kiefernwald gönnen sich hin und wieder ein wenig Ruhe. Nur der Singsang des Teichs verstummt nie völlig; seine Bewohner, so scheint es, bedürfen des Schlafs nicht. Das gilt besonders von den unermüdlich quakenden Fröschen. Kaltblüter nennen wir sie. Gewiß, ihre schlüpfrige Haut fühlt sich kalt an, ihr Fleisch und ihr Blut; aber drin im Herzen, da sitzt es, unsichtbar, das Herz im Herzen, glühend heiß, voll Sehnsucht, voll Liebe, und wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.
Zu allen Zeiten ist man sich des Reizes bewußt gewesen,[37] der vom Froschgesang ausgeht, und es sind nur naturfremde oder krankhafte Menschen, die solchen Minnesang verwünschen. Wieviel ärmer wäre die Frühlingsnacht an unsern Teichen, wenn deren Bewohner, die grünen Wasserfrösche, ebenso stumm wären, wie ihre braunen Vettern im Grase, von denen man höchstens ein paar knurrende Laute vernimmt. Da ist mir der grüne Teichsänger doch hundertmal lieber. Sein Lied stimmt zu den andern Schilfliedern, bringt Leben in die Natur, und wo Leben und Stimmung, wo Bewegung und Einklang, da erkenne ich Schönheit.
Auch der Laubfrosch, unser Wetterprophet, läßt sich bisweilen die ganze Nacht hören. Er hat sich einen Sängerplatz in der Höhe, im Grün von Baum oder Strauch erkoren, von wo nun sein hastig hervorgestoßenes »äpp, äpp, äpp« durch die Frühlingsnacht hallt, seltsam anzuhören und lustig zugleich. Der kleine Kerl dünkt sich so wichtig.
Von tieferem Eindruck auf unser Gemüt ist der Einzelruf oder auch der melodische Rundgesang der Unken, die den Dorfweiher oder den Tümpel draußen im Wiesental bewohnen. Wie Glocken läutet's geheimnisvoll aus der Tiefe »ung, ung, ung …«, feierlich, ernst, schwermütig und traurig, fast immer derselbe Ton, von gleicher Stärke und Höhe. Zu dem dunkeln, ernsten Weiher mit den Wasserrosen, die im Mondlicht nur matt und unsicher leuchten, während die schwarzen Schatten der Pappeln auf der Wasserfläche erzittern, stimmen die melancholischen Glockentöne der Unken so wunderbar, daß jeder den Eindruck dieser Naturlaute empfindet.
Auch manche Insekten, namentlich wenn sie in größeren Scharen auftreten, sind für das ganze Landschaftsbild von Bedeutung. Wir brauchen nur an die graziösen Libellen zu denken, die jedem Gewässer, dem Fluß und Bach mit ihren erlenbestandenen Ufern, dem schilfumsäumten Teich, selbst dem reizlosen Mühlgraben zur Zierde gereichen. »Wasser-« oder auch »Schlankjungfern« hat sie das Volk getauft, um den bezaubernden Reiz dieser zarten Wesen zum Ausdruck zu bringen, im Flug wie im Sitzen von einer Anmut, die nicht ihresgleichen hat. Oder wer möchte sie missen, die Bienen und die andern Hautflügler, die mit Gesumm und Gebrumm im Mai den schneeigen Obstbaum, im Juli die duftende Linde, im August die blühende Heide besuchen! Ein zartes Getön, wie von Millionen silberner oder gläserner Glöckchen erfüllt die sonnige Luft. Oder soll ich an die Musik der Heupferde erinnern, die in der sommerlichen Mittagsglut die Blumen und Gräser zum Schlummer einlullt, oder an das Zirpen der Grillen, das so stimmungsvoll am Abend durch die Flur zittert. Das einzelne Tierchen leistet wohl wenig als Musikant, aber tausend und abertausend vereinigt erzeugen ein eindrucksvolles Getön, das leise über die Landschaft dahinschwebt, einem zarten Schleier aus gesponnenem Glas vergleichbar.
Von weit höherer Bedeutung ist die artenreiche Gruppe der Tagschmetterlinge. Wie stimmen doch diese leichtbeschwingten, zarten Geschöpfe, die Sinnbilder eines heiteren, frohen Lebensgenusses, zu dem sommerlichen Naturbilde mit der Fülle des Lichts und der Farben! In anmutigstem Spiel gaukeln sie von einer Blume zur andern, haschen und fliehen sich, bringen[39] Bewegung und Leben. Möchtest du sie missen auf der sommerlichen Heimatflur? Oder denke an die Frühlingsboten, den ersten Zitronenfalter, das erste Pfauenauge! Ein trügerischer Sonnenblick hat den Winterschläfer geweckt, daß er sein sicheres Versteck verlassen hat und nun über der blumenleeren Erde ruhlos dahinflattert. Armes Tier, Schneewolken ziehen auf, hinter denen sich die Sonne versteckt; wie bald bist du erstarrt! Aber umsonst gelebt hast du nicht. Wir sind dem Frühling begegnet! so jubelt's in uns. Ein vorzeitig »Sommervöglein« nur, und doch etwas Großes!
Leider sind die schönen Falter in unsrer Heimat seit ein paar Jahrzehnten recht selten geworden, namentlich in der Nähe der großen Städte. Selbst die gewöhnlichsten Arten, wie Trauermantel, Admiral, Distelfalter u. a., haben in ganz auffallender Weise an Zahl abgenommen. Segelfaltern und Schwalbenschwänzen, die unser Jungenherz in der schönen Jahreszeit täglich erfreuten, begegnet man nur noch ausnahmsweise, und die selteneren Nachtschmetterlinge, wie rotes und blaues Ordensband, Wolfsmilch-, Ligusterschwärmer u. a., die auch vor einem halben Jahrhundert durchaus nicht häufig waren, scheinen heute fast schon ausgestorben zu sein. Gewiß tragen die Schmetterlingssammler einen Teil der Schuld; aber die Hauptursache dieser bedauerlichen Verarmung der Natur liegt in der fortgeschrittenen Kultivierung des Bodens, wodurch den Raupen vielfach ihre Nahrungspflanzen entzogen worden sind. Jedes Winkelchen wird ausgenutzt, alles Unkraut beseitigt; die Aussaat des Getreides ist reiner als ehemals, die Siedelungen der Menschen sind gewachsen und der Verkehr ist gestiegen.
Die Bedeutung der Tierwelt für das Landschaftsbild kommt uns vielfach erst dann so recht zum Bewußtsein, wenn dieser Reiz, der von dem beseelten Geschöpf ausgeht, irgendwo völlig fehlt. Das Tier bildet einen wesentlichen, zum Ganzen gehörigen Teil der Heimat. Die Harmonie, die Schönheit ist beeinträchtigt, sobald die dem Landschaftsbild eigentümlichen Vertreter der Tierwelt verschwunden sind. Der Reichtum, die Mannigfaltigkeit der Natur hat dann eine schwere Einbuße erlitten – schweigend steht der Wald, tot liegt der See, öde die Flur. Verarmt ist die Heimat und mit ihr unser Leben.
Alle, deren Beruf in Beziehung zur Natur steht, an erster Stelle der Landmann, der Förster, der Gärtner, der Fischer, sollten sich der vielfach hart bedrängten Tierwelt der Heimat annehmen. Nicht um klingende Münze, sondern um edlere Güter handelt es sich, um den unermeßlichen Wert einer reichen, unverdorbenen Natur.
Wenn ich mir als Kind das Paradies der Schöpfungsgeschichte vorstellte, da war es nicht etwa die oasenartige Landschaft mit ihren Palmen und Fruchtbäumen, mit ihren sprudelnden Quellen und Wasserbächen und mit all den unbekannten, üppig wuchernden Stauden und fremdartigen Blumen, wie sie die Bilderbibel mir zeigte, sondern das freundliche grüne Flußtal meiner sächsischen Heimat. Kein schöneres Fleckchen Erde konnte ich mir denken, als diese sanfte, von bewaldeten Höhenzügen umgrenzte Au, durch die mein lieber Heimatfluß zwischen sattgrünen Wiesen seinen Weg nimmt. Hier eine Gruppe mächtiger Eichen und silberstämmiger Buchen, dort dunkles Erlen- und lichtes Weidengestrüpp, das seine Arme weithin über das Wasser breitet; an anderer Stelle, inselartig abgegrenzt, ein dichtes Fichtenwäldchen, ein Laubholzbestand aus Ulmen und Ahornbäumen, mit Haseln und Wildrosen umsäumt, daneben ein Busch junger Birken; am Fuße der Talhänge aber große und kleine Felsblöcke in wirrem Durcheinander, über die das Grün des Adlerfarns schirmartig sich breitet und Weidenröschen ihre roten Blütentrauben erheben, während weißflockige Johanniswedel ihr Bild im Wasser schauen, das sich hier dicht an den Steilhang hinandrängt.
Mitten hinein in die Herrlichkeit dachte ich mir nun Adam und Eva gesetzt, und ich bevölkerte die liebliche Au mit dem »Gevögel, dem Vieh und Gewürm«, davon uns die Bibel erzählt. Aber nicht an die Riesen der Tierwelt dachte ich, Elefant, Giraffe und Nashorn, auch nicht an die Affen und Papageien, die der Bibelmaler auf dem Bilde so friedlich vereinigt hatte, die Tiere der Heimat waren es, die sich hier wirklich ein Stelldichein gaben. Und sie genügten mir, ich kannte sie aber auch alle.
Das Hochwild trat am Abend aus dem dunklen Tann zur Äsung auf die Wiese; die Fähe schnürte von ihrem Bau, vor dem die Jungfüchse spielten, nach dem andern Talhang hinüber; rote Eichkätzchen kletterten die glatten Stämme der Fichten empor und knapperten an den Jungtrieben; die Igelmutter führte ihre hoffnungsfrohe Schar durch das raschelnde Laub; auf dem feuchten Grund des Buchenwaldes gelbfleckige Erdsalamander; im Sumpf Ringelnattern und Frösche; in den Wassergräben gelbbauchige Unken, Kamm- und Teichmolche; auf der Wiese Schmetterlinge ohne Zahl, Heupferde, Maulwürfe und Schermäuse. Und erst im und am Flusse, welch fröhliches Leben: zierliche Wasserjungfern mit tiefblauen oder glasartigen Netzflügeln, Wasserläufer und kleine silberglänzende Fischchen in unendlicher Menge. Überall aber das fröhliche Heer der gefiederten Welt: Schwälbchen, die so hurtig über dem Wasser dahinschossen; von dem Eichenhain her lustiger Kuckucksruf, dem des Pfingstvogels Flöte Antwort gab; im Unterholz das geschwätzige Plauderliedchen der Gartengrasmücke oder der jubelnde Überschlag des Plattmönchs; im Hochwald das Gezeter zänkischer Eichelhäher,[43] das Trommeln der Buntspechte, das Gurren der Ringeltauben; über allem aber, hoch am strahlenden Himmel ein Bussardpaar, einander umkreisend, ohne Flügelschlag schwimmend im Luftozean.
Aber auch Haustiere fanden ihren Weg nach meinem Garten Eden. Am Hange hütete Thomas, der alte Schäfer vom Rittergut, seine sanfte Herde; am Ufer Jungvieh auf eingekoppelter Weide, und auf dem Fluß schnatternde Gänse und Enten. Brauchte ich da noch andere Tiere aus fernen Zonen? Oh, es war eine große, eine unübersehbare Reihe, die da vor Adam in geordnetem Zuge vorbeimarschierte, hüpfte, schwamm oder kroch, als der Schöpfer all die Tiere zum Menschen brachte, »daß er sähe, wie er sie nennete«; denn wie jener sie nannte, so sollten sie heißen ihr Leben lang.
Da hüpfte die vorlaute Elster heran im schwarzweißen Kleid; wohlgefällig wippte sie ihre grün und purpurn schillernde Schleppe auf und ab und schaute neugierig zu dem ersten Menschen hinüber, wobei sie mit Markolf, dem Eichelhäher, fortgesetzt plauderte. »Plapperelster sollst du heißen dein Leben lang, du schwatzhaftes Wesen«, sagte Adam, und schackernd schwang sich der langschwänzige Vogel in die Wipfel der Bäume. Da nahten zögernd die sanften Wollenträger, der Bock mit den geringelten Hörnern und neben ihm seine hornlose Gattin. »Schaf sei euer Name hinfort!« entschied der Mensch, »denn ihr seht ebenso dumm aus, wie ihr in Wirklichkeit seid!« Schon trabte das Borstenvieh grunzend herbei, Füße und Rüssel vom schlammigen Boden besudelt, in dem es soeben noch gewühlt hatte. »Schwein nenne ich dich – frage nicht weiter; du weißt schon warum!« und so ging's vorüber in endlosem Zug: Adler[44] und Gimpel, der stachlige Igel, der furchtsame Hase, Frosch und Unke, Käfer und Spinne, das Gewürm, das im Grase herankroch, und die Fische im Fluß, zwei-, vier-, sechs-, achtbeinig und ohne Beine, befiedert, bepelzt, beschuppt und nackthäutig; sie alle bekamen ihre Namen, die sie heute noch tragen. Was war doch der erste Mensch für ein weises Geschöpf!
Und von dieser Weisheit hatte auch ich kleines Menschenkind ein Stückchen geerbt. Denn in der kindlichen Phantasie liegt Weisheit und Wahrheit wie im kindlichen Spiel, Weisheit und Wahrheit wie in jenen köstlich-naiven Worten des biblischen Schöpfungsberichts. Nicht die leblose Welt ist's, nicht Erde, Wasser und Stein, nicht die blitzenden Krystalle sind's, die farbigen Kiesel, ja nicht 'mal die Bäume und Sträucher im Wald oder Garten, nicht die bunten duftenden Blumen, die das Interesse des ersten Menschen zuerst auf sich lenken, sondern die Tiere.
Und wie Adam, der erste Mensch, am Schöpfungsmorgen dem »Gevögel, dem Vieh und dem Gewürm« seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte und nichts von den andern Herrlichkeiten sah, die Gottvater um ihn aufgebaut hatte – die Tiere mußten erst ihre Namen haben, ehe er sich den Fruchtbäumen des Gartens Eden zuwandte – so bringt auch heute noch jedes Kind seine erste Teilnahme, seine erste Liebe den Tieren entgegen. Noch ehe unsre Kleinen Worte zu lallen beginnen, hören sie auf die Stimme des Vogels und beobachten die Bewegungen von Katze und Hund. Und sie geben, wie Johannes Fischart so reizend sagt, »nach jrer Notturfft Namen, brauchen den ererbt Adams gwalt, der jedem Geschöpff[45] ein Nam' gab bald«. »Wauwau« der Hund und »Miau« die Katze, »Muh« die Kuh und »Piep-piep« das Spätzlein. Ja es kommt vor, daß solch kleines Menschenkind mit den genannten Tieren seiner Umgebung innigere Freundschaft geschlossen hat, als mit dem strengen Papa, den es nur selten sieht und vor dem es sich fürchtet. Es ist auch, als ob die Tiere diese Zuneigung der Kinder fühlen:
Und wenn dann der Kleine seine ersten Entdeckungsreisen in Hof und Garten unternimmt, wie weitet sich da der Kreis solcher Freundschaft! Das bunte Marienkäferchen, die Schnecke mit ihren spaßhaften Fühlhörnern, der summende Maikäfer oder der Schnellkäfer, das hüpfende Heupferd sind seine Lieblinge. Der Tag, an dem der Star das erstemal wieder vor seinem Bretterhäuschen sitzt, wird zum Festtag. Klopfenden Herzens lauschen die Kinder dem stillen Glück der Hausrotschwänzchen, die im verborgenen Winkel der Gartenlaube ihre Jungen aufziehen, bis endlich die Stunde kommt, wo die kleinen grauen Federbällchen den ersten Schritt in die Welt wagen.
Und dann die Geschichten und die Lieder, die unsre Kleinen am liebsten hören und singen, die Bilderbücher, die sie am liebsten besehen, handeln nicht die meisten von Tieren? Der böse Wolf, der Rotkäppchen verschlang, der Fuchs, der die Gans gestohlen hat, der Storch, der den Eltern die Kinder bringt, eins nach dem andern, bisweilen auch zwei auf einmal, der »gestiefelte Kater«,[46] die »Bremer Stadtmusikanten«; ja auch in den Geschichten, in den Bilderbüchern, wo Tiere nicht gerade die Hauptrolle spielen: zur Vervollständigung und zum Schmuck der Erzählung oder des Bildes sind sie unentbehrlich für das Kind. Wäre es denkbar, das Märchen von Aschenbrödel ohne die Tauben, die beim Erbsenlesen helfen: »die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen«, das Märchen von der Gold- und der Pechmarie ohne den krähenden Haushahn? Und warum besehen die Kinder so gern die hübschen Bilder unsers Landsmanns Ludwig Richter? Weil er wie kaum ein anderer Maler die Kindesseele verstanden hat, und weil sich in jeder Familienstube, die er so anheimelnd zeichnet, ein Haustier findet, ein Hund, eine Katze. Und auch im Freien, wo sich die Kinder tummeln, da schaut auf jedem Bilde ein Spitz zu oder ein Spatz, ein Taubenpaar oder irgend ein Singvogel, und dieser scheinbar so geringfügige Umstand ist für den kleinen Beschauer von allergrößtem Reiz.
Als ich ein Kind war, da standen mir – ich muß es gestehen – die Tiere meiner Umgebung näher, und es verband mich mit ihnen ein innigeres Verhältnis als mit den Menschen, abgesehen natürlich von Eltern und Geschwistern. Lange ehe ich etwas von Darwins Abstammungslehre hörte, war ich schon unbewußt ein kleiner Darwinianer; denn mit dem Star und dem Finken, dem Hund und der Katze, der Ringelnatter und der Kröte, dem Marienkäferchen und der Schnecke verkehrte ich, als seien es meine Brüder und Schwestern. Und auch viel später noch, wenn man mir vom »unvernünftigen Vieh« sprach, habe ich nie so ganz die unüberbrückbare Kluft begriffen, den gähnenden Abgrund, der sich[47] zwischen dem Menschen und dem höheren Tiere auftun soll.
Doch was rede ich von mir? Es haben's ja alle genau so oder ähnlich in den Tagen der Kindheit getrieben. Dem Hahnenschrei legen die Kinder die Worte unter: »Kikerikieh, ich bin das schönste Vieh«; der Goldammer versichert sie seiner Zuneigung: »Wie, wie hab' ich dich lieb!« und mit dem kecken Meislein spielt man Verstecken: »Sitz i da, sitz i da!« rufen sie beide einander zu, das Vöglein droben im grünen Baum und unten der Kleine, der zu ihm aufschaut.
Warum ich dies alles erzähle? Weil ich nicht eindringlich genug daran hinweisen kann, daß das innige Verhältnis des Menschen zur Tierwelt der Heimat etwas Ursprüngliches ist, etwas Angeborenes, daß es etwas Triebartiges an sich hat und sich am reinsten in der Kindheit offenbart, sowohl beim einzelnen Kind jeder Familie, jedes Volksstammes und aller Zeiten, wie bei der Kindheit des Menschengeschlechts in grauer Vergangenheit. Nur wenn wir dies wirklich erkannt haben, wird es uns klar, warum die Tiere eine so große Rolle in Sage und Märchen und Fabel spielen und warum der Aberglaube des Volks sie mit einem Kranz buntfarbiger Blumen umgeben hat.
In dieser Beziehung herrscht unter allen Völkern die größte Übereinstimmung, mögen wir an die dichtende Phantasie der uns verwandten Kulturnationen denken oder an die zum Teil unbeholfenen Erzählungen unzivilisierter Horden. Sie alle besitzen uralte Sagen und Märchen, die meisten auch Fabeln und Parabeln, in denen Tieren eine Hauptrolle zukommt. Und so sind[48] »diese kleinen spielenden Kinder der allgegenwärtigen Muse der Poesie« Gemeingut der Menschheit. Ja die Gemeinsamkeit solches Besitzes geht so weit, daß einzelne Tiermärchen oder Tierfabeln in den entferntesten Zonen, wo eine Überlieferung oder auch nur mittelbare Beeinflussung völlig ausgeschlossen erscheint, durchaus miteinander übereinstimmen und vielen Tieren hier wie dort die gleichen Wesenszüge zugeschrieben werden. Selbst unsre lieben deutschen Märchen, die Großmütterchen am Herd ihren lauschenden Enkelkindern erzählt, haben ihre Wurzeln zumeist nicht in der grauen Vorzeit der germanischen Volksstämme, sondern sind im fernen Indien geboren, wie die Forschungen der vergleichenden Literaturwissenschaft überzeugend dargetan haben. Aber bei keinem andern Volke, das dürfen wir getrost behaupten, sind sie mit gleich gemütvollen Zügen, namentlich auch aus der Tierwelt, ausgestattet worden, wie bei uns Deutschen und höchstens noch bei den Slawen. Ihnen darf man mit Recht nachrühmen, im innigsten Verhältnis zur Tierwelt zu stehen. Die Kinder- und Hausmärchen – ich meine, so gemütvoll, wie sie von Gebrüder Grimm erzählt werden – kann kein anderes Volk aufweisen, und Fabeldichter haben gerade wir Deutschen in reichster Fülle von Ulrich Boner und Burkard Waldis an bis Leixner, Fulda, Bierbaum, Etzel, Ewers u. v. a.
Den freundlichen Leser, der mir bis hierher gefolgt ist, möchte ich nun einladen, sich auf dem bemoosten Felsblock niederzulassen, der einst unserm gemeinsamen Stammvater zum Sitz gedient hat, und möchte an seinem[49] geistigen Auge einen kleinen Teil der Tiere vorüberführen, von denen unsre Märchen und Fabeln erzählen, die also unserm deutschen Volke am nächsten stehen, die volkstümlichsten sind. Dabei schalte ich aber alle fremdländischen Tiere, selbst den König des großen Reiches aus, ebenso unsre Haustiere. Denn ich möchte an erster Stelle unsre »Brüder«, die mit uns die Heimaterde bewohnen, allen Lesern recht warm an's Herz legen und Teilnahme für sie wecken. Gerade die volkstümlichsten unter ihnen, wenigstens eine große Zahl dieser Märchenhelden und Fabeltiere, wenn ich sie so nennen darf, bedürfen dringend des allgemeinen Schutzes, sollen sie nicht in längerer oder kürzerer Zeit spurlos aus der Heimat verschwinden.
Der Nutzen und Schaden, den die einzelnen Tiere dem Menschen bringen, ist bereits im Übermaß immer und immer wieder erörtert worden, und die Bestrebungen des Naturschutzes, solch einseitiges Urteil doch nicht als einzigen Maßstab unseres Verhaltens den Tieren gegenüber gelten zu lassen, sind bereits Allgemeingut geworden, so daß ich kein Wort hierüber zu verlieren brauche. Der Hinweis aber, daß eine reiche Tierwelt zur Belebung der Landschaft in erfreulichster Weise beiträgt, ist im vorigen Abschnitt behandelt worden, auch habe ich bereits an anderer Stelle betont, wie eine mannigfaltige, möglichst ursprüngliche Tierwelt für die Wissenschaft von hervorragender Bedeutung ist. Aber ich meine, auch die Volkstümlichkeit mancher Tiere – ich denke z. B. an den Fuchs und den Igel, den Storch, die Schwalbe, den Kuckuck, an alle Eulen – sollte ein recht wesentlicher Grund sein, für den unbedingten Schutz solcher Tiere einzutreten.
Der volkstümlichste Held des deutschen Märchens wie der deutschen Fabel ist entschieden der Fuchs. Schlauer und verschlagener als alle andern Geschöpfe, spielt er die Rolle des Betrügers. Er überlistet die Wildente und den Hasen, den Gockel und seine Hennen, die Gans, den Raben, den Igel, den Dachs, kurz alle Tiere in Feld und Wald, in Haus und Hof. Selbst seinen großen Vetter Isengrim mit dem gewaltigen Wolfsrachen, oder Braun, den Bär, der ihn mit einem Schlage seiner mächtigen Pranken zu Boden strecken könnte, fürchtet der Spitzbube nicht. Er kennt die Schwächen jedes einzelnen, weiß seine Gegner alle zu foppen und spielt ihnen aufs übelste mit; selbst den Jäger führt der Schlaue oftmals hinter's Licht. Soll es wirklich dahin kommen, daß solch volkstümliches Tier, von dem jedes Kind zu erzählen weiß, völlig aus unsrer Heimat verschwindet? Soll es dahin kommen, daß nie mehr ein Fuchs unsern Weg kreuzt in sandiger Heide und daß wir den Roten nur noch hinter den Gittern sehen im zoologischen Garten oder ausgestopft im Museum? Das wäre doch traurig.
Oder der Storch. Von ihm gilt dasselbe. Alle Kinder kennen ihn aus den Bilderbüchern, aus mancherlei Reimen, aus dem Märchen vom »Kalif Storch«. Daher die ganz unsagbare Freude, wenn man einen wirklich 'mal sieht droben am Strohdach der Scheune, oder einherstolzierend auf feuchter Wiese oder auf dem Rain zwischen den Äckern, wenn man sein gemütliches Klappern vernimmt und den ersten Flugübungen der drei oder vier Jungen zuschaut, die den Horst zaghaft verlassen. Soll wirklich die Zeit kommen, wo auch das letzte brütende Storchenpaar und der letzte Horst aus unserm engeren Vaterlande verschwunden sein wird, wie[51] der Adler, der Reiher, der Kolkrabe und so manche andre. Wie viel Schönheit, wie viel Poesie wäre dahin, für alle Zeiten unwiederbringlich dahin! Mögen alle, die's angeht, dafür sorgen, daß diese gefährdeten Tiere vor dem drohenden Untergang bewahrt bleiben und daß sich auch noch unsre Enkelkinder an ihnen erfreuen können, wie unsre Altvordern, die so viele gemütvolle Märchen und unterhaltsame Fabeln von diesen Tieren zusammenreimten.
Freilich die großen Raubtiere sind längst aus unserm Lande gewichen. Sie passen nicht mehr in unsre heutigen Verhältnisse, und es wäre töricht, sie zurückzuwünschen. Braun, der Bär, der grobe, aber gutmütige Gesell, hat innerhalb der deutschen Grenzen seit etwa hundert Jahren das Heimatrecht verloren, und es vergeht bisweilen mehr als ein Jahrzehnt, ehe sich 'mal wieder einer, aus Tirol versprengt, in den bayrischen Alpen zeigt. Wie häufig aber ehemals auch in den deutschen Mittelgebirgen Meister Petz war, das beweisen die vielen mit »Bär« zusammengesetzten Ortsnamen, auch hier in Sachsen: Bärenfels, Bärenhecke, Bärenburg u. a.
Unsre Vorfahren, die alten Germanen, kannten den Bären recht gut, hatte er doch sein Heim in allen Dickungen aufgeschlagen, von wo er die mühsam dem Walde abgerungenen Felder heimsuchte und in die Viehherden einbrach. Mit dem Speer bewaffnet, die Hunde zur Seite, so zogen die germanischen Jäger auf die Bärenhatz. Das Wildbret des gewaltigen Tieres war ihnen ebenso willkommen wie das zottige Fell, auf dem sie, wie es im Liede heißt, lagen und – »immer noch eins« tranken. Mit der fortschreitenden Bodenkultur und der[52] zunehmenden Bevölkerung aber mußte die Zahl des großen Raubtiers zurückgehen. Dazu kamen mancherlei Verbesserungen der Jagdwaffen und die Einführung besonderer Jagdarten, die eine Verringerung herbeiführten. In der Zeit von 1611 bis 1717, also innerhalb 106 Jahren, wurden in dem damaligen Sachsen, das allerdings wesentlich größer war als unser heutiges, nach den aufbewahrten Jagdverzeichnissen noch immer 709 Bären zur Strecke gebracht. Heute ist der Bär selbst in den österreichischen, den schweizer und italienischen Alpen recht selten geworden; dagegen beherbergt ihn noch so manches Hochtal der langen Karpatenkette, sowohl in der Slowakei wie in den rumänischen Südkarpaten. Die Bären unsrer zoologischen Gärten stammen zum größten Teil aus Siebenbürgen, das auch heute noch mit Recht als »Bärenland« bezeichnet wird. Ich habe die Spuren des mächtigen Herrn der dortigen Gebirgswelt auf meinen Reisen wiederholt beobachten können. In den ehemals ungarischen Karpaten wurden noch vor kurzer Zeit in einem einzigen Jahre – es steht mir die Zahl vom Jahre 1908 zur Verfügung – noch immer 245 Bären erlegt.
Mit dem Bären ist vielleicht der Dachs am nächsten verwandt. In Fabel und Märchen spielt er als Meister »Grimbart« eine große Rolle. Alle Waldgebirge Deutschlands beherbergen wohl noch den griesgrämigen Einsiedler; aber die letzten Jahrzehnte haben doch auch mit ihm stark aufgeräumt. Ich habe die meisten Gebirgswälder unsrer deutschen Heimat durchstreift, bin Reineke oftmals begegnet und habe mich an dessen hoffnungsfroher Jugend erfreut, selbst den Edel- und den Steinmarder habe ich in freier Natur angetroffen; aber[53] alt bin ich geworden, ehe mir Grimbart über den Weg gelaufen ist. Das ist gewiß nur persönliches Mißgeschick gewesen; indessen, wenigstens für unsre engere Heimat, muß man einen besetzten Dachsbau doch bereits zu den Naturdenkmälern zählen. In andern Gegenden freilich ist Meister Grimbart etwas häufiger.
Der Dachs ist übrigens weit weniger Raubtier als seine entfernte Vetternschaft, die Sippe der Marder. Wohl verschmäht er einen Junghasen nicht, Fasanen und Hühner mögen sich vor ihm hüten; aber er vertilgt auch Mäuse, Kerbtiere, Schnecken und Würmer, und gern frißt er allerlei Beeren, worauf schon sein Gebiß mit den schwachen Reißzähnen hinweist. Und so ist die Schonzeit gerechtfertigt, die er bei uns vom 1. Februar bis zum 31. August genießt. Er ist leider das einzige Raubtier, das sich eines solchen Vorzugs erfreut.
Ein viel schlimmerer Geselle, mit dem Dachs gar nicht zu vergleichen, auch nicht mit dem Bär, ist oder war der Wolf. Wir hören noch gern die netten Geschichten, die das deutsche Märchen von Isengrim zu erzählen weiß, wie er von dem schlauen Reineke, dem er an Stärke weit überlegen ist, immer überlistet wird, wie ihn sein sprichwörtlich gewordener »Wolfshunger« in hundert Abenteuer verwickelt und an den Rand des Verderbens lockt; wir gedenken so gern noch der verschiedenen Rollen, die der Wolf in der Fabel spielt, wo er im Verein mit seinem Vetter, dem Hund, auftritt oder mit der Wildsau, dem Pferde, dem Lamm, der Gans, dem Löwen, wie er in den meisten Fällen tüchtig verprügelt wird oder wie er im Angesicht des Todes sein Testament macht; ja, wir gedenken seiner noch gern als eines der volkstümlichsten[54] Tiere, aber wir trauern nicht um ihn und wünschen ihn nicht zurück.
Ehemals mag der Wolf fast überall in deutschen Landen in recht großen Scharen aufgetreten sein, in den Mittelgebirgen sowohl, wie namentlich in den weiten Ebenen des Ostens. Wurden doch in jenen 106 Jahren allein in Sachsen 6937 Wölfe zur Strecke gebracht, wobei die nur gelegentlich von einzelnen Bauern erlegten nicht mitgezählt sind. Man kann sich denken, welch furchtbare Geißel Isengrim damals für die Herden wie für das Wild war, daß die Bewohner von Einzelhöfen, ja ganze Dorfschaften sich zusammentaten und Treibjagden gegen den Bösen unternahmen oder ihn in Wolfsgruben fingen und erschlugen, und daß die fürstlichen wie geistlichen Jagdherren ihm nachstellten und Belohnungen auf seine Haut ausschrieben, i. J. 1614 z. B. nicht weniger als vier Taler, i. J. 1730 zehn Taler, ein schönes Stück Geld damals. Vielleicht hat der Wolf weniger der Kultur des Landes, als der fortgesetzten Verfolgung zwangsweise weichen müssen. Für seinen Wolfshunger gab es in unserm Vaterlande eben keinen Raum mehr. Nach Osten ist er verdrängt worden, von wo er gegenwärtig nur vereinzelt einmal in recht strengen Wintern über die deutsch-polnische Grenze wechselt. Im Wasgau, ebenso in der Eifel erscheint wohl auch noch ab und zu ein versprengter Isengrim, der dann gewöhnlich sehr schnell einer Kugel zum Opfer fällt. In Sachsen war es bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit den Wölfen vorbei; ja schon kurz vor dem Siebenjährigen Krieg können die Raubgesellen hier als ausgerottet bezeichnet werden, und nur einzelne Namen wie Wolfsgrün, Wolfsschlucht, Wolfsheim, Wolfsberg, Wolfshügel[55] erinnern noch an die einstige Glanzzeit der mordgierigen Bande. Aus unsrer Dresdner Gegend scheint der Wolf schon recht frühzeitig gewichen zu sein; wenigstens galt er hier zu Anfang des 17. Jahrhunderts bereits als Seltenheit, sonst würde man ihm nicht i. J. 1618 eine sog. »Wolfssäule« im Friedewald, in der Nähe der Landstraße von Meißen nach Moritzburg, errichtet haben. Die Inschrift der 6 Meter hohen Steinsäule, auf der ein sitzender Wolf ruht, besagt, daß Kurfürst Johann Georg I. diesen Wolf »behetzet und beschossen« habe. Das Denkmal ist oftmals ausgebessert worden, zuletzt i. J. 1919.
Ein zweites Wolfsmal steht in der Heide zwischen Ottendorf und Laußnitz, seitwärts der Königsbrücker Landstraße, am Wolfsberg. Es erinnert an einen Wolf, der am Martinstag 1740 hier abgeschossen ward, der erste wieder in dieser Gegend seit 56 Jahren.
Bekannt ist auch die nur etwas über 2 Meter hohe, pyramidenförmig zugespitzte Wolfssäule in der Dippoldiswalder Heide, an dem Wege von Malter nach der Heidemühle. Sie zeigt in recht unbeholfenem Flachrelief einen Wolf, darunter die Inschrift mit der Zeitangabe 6. März 1802. Ohne Zweifel ist dieser »letzte« sächsische Wolf, wie ihn der Volksmund bezeichnet, nur ein Überläufer aus den böhmischen Wäldern gewesen. Dort, ebenso in Schlesien, hat sich der Wolf bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts erhalten. Oft hört man erzählen, daß die Wölfe i. J. 1813 der vernichteten Armee Napoleons in ganzen Rudeln nach Deutschland, insbesondere auch nach Sachsen, gefolgt seien; doch es fehlt der Beweis für solche recht wenig wahrscheinliche Annahme. Wenn im letztvergangenen Jahrhundert, ja noch 1904, in Sachsen oder nahe der sächsischen Grenze hier und[56] da ein Wolf erlegt worden ist, so handelte es sich um gefangene, irgendeiner Menagerie entsprungene Tiere, falls nicht die Phantasie des glücklichen Schützen in einem wildernden wolfsähnlichen Hunde den leibhaftigen Isengrim erblickte. Ausführliches über die Geschichte des Wolfs in Sachsen enthält ein Aufsatz A. Klengels in den Mitteilungen des Sächsischen Heimatschutzes, Bd. 9, S. 97 ff.
Auch der kleinere Vetter, der Fuchs, hat viel unter der Feindschaft des Menschen zu leiden, der ihm mit Eisen und Blei und mit vergiftetem Köder nachstellt. Aber noch immer hat es der Erzschelm verstanden, sich zu behaupten. Jeden sucht er zu prellen, zu betrügen, der seinen Weg kreuzt. Eine Legion lustiger Geschichten und unterhaltsamer Späße, die sich die dichtende Phantasie zusammengereimt hat, von den Tagen Äsops an bis zu Goethes Tierepos und den Fabeldichtern unsrer Tage.
In jedem größeren Revier, auch bei uns im so stark bevölkerten Sachsen, gibt es noch Füchse. »Mehr als genug!« denkt mancher Grünrock, der seine Niederjagd liebt. Ja, in den vergangenen Kriegsjahren haben sich die Roten eher vermehrt als vermindert. »Das Raubzeug hat im deutschen Wald überhand genommen,« so klagte man mir, »ganz besonders die Füchse«. Das Versäumte, glaube ich, wird bald wieder nachgeholt sein. Der hohe Preis von Reinekes Winterbalg ist gewiß ein gewaltiger Ansporn für den Jagdberechtigten, den Fuchs zu schießen oder ihn im Eisen zu fangen – ein schönes Sümmchen, das solch ein Balg bringt, der Mühe schon wert, einmal zu nachtschlafender Zeit das warme Bett mit dem klirrenden Frost draußen am Hochsitz zu vertauschen, auch wenn's kein feiner »Silberfuchs« ist – andererseits[57] wird solch hoher Preis den Wunsch stärken, den Fuchs im Revier nicht völlig zu missen. Heute wird es der Jäger wohl unterlassen, falls nicht besondere Gründe vorliegen, die Welpen mit dem noch wertlosen Balg aus ihrem Bau auszugraben, und so wird die Zeit hoffentlich recht fern sein, wo auch der Fuchs aus dem deutschen Walde verschwunden ist, wie Wolf, Luchs und Wildkatze.
In den Kreisen der Landwirte und Forstleute hat man schon seit einiger Zeit begonnen, die Bedeutung der Raubtiere mehr und mehr einzusehen, und wenn auch heute noch hie und da ein einzelner Jäger ein geschworener Feind alles »Raubgesindels« ist, so beweist er nur, daß er von der Lebensweise der Raubtiere, der bepelzten wie der gefiederten, keine rechte Vorstellung hat. Gerade der Fuchs vertilgt eine Unmenge von Mäusen, und er ist so lüstern auf dies winzige Wildbret, daß er sich trotz aller Vorsicht und Schlauheit durch leises »Mäuseln« des Jägers heranlocken läßt. Daneben aber frißt er auch Kerbtiere und deren Larven, namentlich Maikäfer, Saateulenraupen und Drahtwürmer. Daß er nur von Hühnern und Fasanen, von Hasen und Kaninchen lebe, ist eine böse Verleumdung. Natürlich, was er überlisten kann, nimmt er mit; selbst das Reh fällt ihm zum Opfer; aber doch nur, wenn es an den Läufen klagt, die die harte Schneekruste ihm zerschnitten hat, und wohl auch ohne Hilfe des Fuchses eingegangen wäre. Reineke, und das sollte man ihm nie vergessen, ist aber auch jagdlich insofern von Nutzen, als er an erster Stelle kümmernde, kranke und schwache Stücke erbeutet und dadurch der Ausbreitung von Seuchen vorbeugt,[58] sowie durch solche Auslese den ganzen Stand des Wildes hebt und stärkt.
Bei Bekämpfung des Raubzeugs kennen einzelne Jäger keine Rücksicht, und es läuft ebenso häßliche wie unnötige Roheit und Tierquälerei da mit unter. Oder ist es keine Roheit, die Fähe in der Heckezeit abzuschießen, daß die Welpen im Bau elend verhungern müssen, oder das Habichtsweibchen am Horst wegzuknallen und so die Jungvögel einem elenden Tode preiszugeben? Ist's nicht Tierquälerei, den Fuchs vierundzwanzig Stunden im Eisen sich abquälen und Eulen oder Bussarde tagelang mit zerschmetterten Fängen in dem Marterinstrument hängen zu lassen? Wo der Jäger sich des »Raubgesindels«, wie er's nennt, nicht anders glaubt erwehren zu können, als daß er Fallen legt und Eisen stellt, da hat er die Pflicht und Schuldigkeit, am frühen Morgen nachzusehen, ob sich ein Tier gefangen hat. Wer es unterläßt, macht sich ebenso der Aasjägerei schuldig wie einer, der auf fünfzig Schritt Rehe oder Rotwild mit Schrot anspritzt oder ein angeschweißtes Stück Wild nicht nachsucht. Aber den Räubern gegenüber befinden sich die Jäger noch oft, wie Löns schreibt, in einem mittelalterlichen Irrwahn; »der Fuchs ist ihnen ein Dämon, der nachts umgeht und suchet, was er verschlinge«.
Von anderem Raubwild weiß das Märchen nur wenig. Den Luchs, der in Deutschland bereits völlig ausgestorben ist, kennt es kaum, und wo die Katze auftritt, da handelt es sich in den meisten Fällen um unsre Hausmiez, nicht um die Wildkatze. Diese ist bis auf wenig Reste aus den deutschen Forsten verschwunden; nur die zusammenhängenden Waldungen, die Dickungen und Felsenklüfte an der Mosel und im Südharz bieten[59] Hinz, dem Kater, dem kraftstrotzenden, gelenkigen Räuber, noch gute Verstecke. In bewohnteren Gegenden kann man die Wildkatze nicht dulden; sie hat der Kultur weichen müssen. Aber noch recht häufig kommt sie in den Karpaten vor, wurden doch im Jahre 1908 noch 5045 Wildkatzen im damaligen Ungarn zur Strecke gebracht.
Und nun unser gemütlicher Igel. Wer kennt es nicht, das köstliche Märchen von »Swinegel un siner Fru«, wie sie beim Wettlauf den flüchtigen Lampe betrügen, und die lustige Lehre, die Gebrüder Grimm hinzufügen, »datt et gerahden is, wenn eener freet, datt he sick 'ne Fru ut sienem Stande nimmt, un de just so uutsäht es he sülwst. Wer also en Swinegel is, de mutt tosehn, datt siene Fro ook en Swinegel is«. Oder wer kennt sie nicht, die Fabel vom Igel und dem Hund, der sich an dem stachligen Gesellen die Nase blutig sticht, oder die Geschichte vom Igel, der auswandert, weil er von allen Tieren seiner Stacheln wegen mißachtet und beschimpft wird, und zufällig ins Land der Stachelschweine kommt, wo alle Einwohner ganz entzückt ausrufen:
Woran H. H. Ewers die Moral knüpft:
Ein köstliches Bild, wenn man 'mal im raschelnden Herbstlaub einer Igelmama mit ihren vier oder fünf »lütjen Kinners« begegnet, kleinen, spaßhaften Stachelkugeln,[60] die man gern 'mal in die Hand nimmt. Und dieser Mäuse- und Insektenvertilger wird – man sollte es kaum glauben – gleichfalls von manchem Jäger verfolgt, da sein schnupperndes Näschen natürlich auch 'mal ein bodenständiges Nest findet und der Igel dann nicht lange danach fragt, ob es ein paar Regenwürmer sind oder Jungvögel, die er entdeckt hat. Ich kenne wenig Tiere, die als Mäusefänger so nützlich, zugleich aber in ihrer ganzen Erscheinung und in ihrem Gebaren so lustig und interessant sind wie der Igel, und ich möchte alle Leser bitten, Swinegel und seiner Familie das allergrößte Wohlwollen entgegenzubringen.
Lampe, der Hase, kommt gleichfalls oftmals in Märchen und Fabeln vor; er ist immer das arme, geplagte, verfolgte Tier: alles, alles will ihn fressen, zumal der Mensch. Um sein Aussterben brauchen wir aber kaum Sorge zu tragen. Der strenge Jagdschutz nimmt sich seiner an; denn der Hasenbestand ist meistens der Wertmesser des ganzen Reviers, wenigstens im Niederland. Freilich, wer in den letzten Jahren lediglich den Ladentischen unsrer Wildbrethandlungen seine Aufmerksamkeit geschenkt hat, die fast immer »hasenrein« waren, der muß zu der Ansicht gekommen sein, daß man entweder Lampe neuerdings aus der Liste der jagdbaren Tiere gestrichen und ihm ewige Schonzeit zugebilligt habe, oder daß es mit dem Hasenfuß auf unsern Fluren für immer vorbei sei. Aber die Sache hat andere Gründe, die ich hier nicht erörtern will.
Allerdings mit der Jagd steht es heute schlimm genug. Überall Wilddiebe, die ihr dunkles Gewerbe treiben! In manchem Revier sind schon alle Rothirsche abgeschossen, in fast jedem ihre Zahl stark gezehntet worden.[61] Und wie die fürstlichen Jagdherren gewiß manchmal in nicht gerechtfertigter Weise zum Schaden des Landwirts, auch der Forstwirtschaft, das Hochwild über die Maßen hegten und pflegten, so verfällt man jetzt ins Gegenteil. Man knallt alles nieder oder wenigstens weit mehr als nötig ist. Es erinnert dieser Vorgang ans Jahr 1848. Auch damals hat man den Rotwildstand, z. B. in unserm Sachsen, so arg abgeschossen, daß ernstlich die Frage erörtert wurde, ob damit nicht das Ende des Rotwilds für alle Zeiten gekommen sei. Und heute stehen Naturfreund und weidgerechter Jäger vor derselben bangen Frage. Nur ist keine Aussicht vorhanden, daß irgendein Jagdherr in Zukunft in der Lage sein wird, sein Wild so zu schützen, zu hegen und zu pflegen, wie es bisher der Fall war.
Es tut einem das Herz weh, wenn man bedenkt, daß der Hirsch, von dem die Tierfabel so manches zu berichten weiß, daß sogar das zierliche Reh, das in vielen Märchen eine besonders liebliche Rolle spielt, vielleicht in recht naher Zeit aus unsern heimatlichen Wäldern, wenn auch nicht völlig verschwinden, so doch hier immer seltener werden soll2. Die Freude an der Natur, an der Jagd, an dem Wild liegt unserm Volke im Blut, ein Erbgut aus Urväterzeit. Und wenn es gewiß auch eine falsche Vorstellung ist, daß die alten Germanen nur von der Jagd lebten – im Gegenteil, sie waren seßhafte Ackerbauern und hatten es schon zu Beginn unsrer Zeitrechnung in der Art, wie sie ihre Ländereien bestellten,[62] weiter gebracht, selbst als die Römer – so war doch die Jagd von großer Bedeutung für sie.
2 Bis vor kurzem wenigstens war das zu befürchten; erst in allerletzter Zeit scheint sich der Rehstand hier und da wieder erfreulich gehoben zu haben.
Aber ist sie es nicht auch noch in der Gegenwart? Es sind sich wenig Menschen, auch die nicht, die gern einmal einen Hasenbraten oder eine Rehkeule verzehren, darüber klar, welche ungeheuren Werte unser Wildbestand darstellt. Man hat berechnet, daß unmittelbar vor dem Kriege die jährliche Ausbeute an Wildbret im Deutschen Reiche 20 Millionen Kilogramm betrug, damals im Werte von wenigstens 25 Millionen Mark, daß die Decken, Schwarten, Bälge einen Marktpreis von gegen 1½ Millionen besaßen, daß der Erlös an Geweihen und Gehörnen etwa 1 Million betrug. Das Reich nahm beinahe 6 Millionen Mark aus den Jagdscheinen ein, die Gemeinden schlugen 40 Millionen aus den Jagdpachten heraus. Dazu kommen die Millionen, die Jagdaufseher, Treiber, Hundezüchter, Waffen-, Munitions-, Jagdbekleidungsfabrikanten u. a. verdienen. (Vgl. H. Löns, Kraut und Lot, S. 105 ff.)
Aber diese volkswirtschaftliche Bedeutung der Jagd ist nicht die Hauptsache. Der Jagdschutz, wenn er streng durchgeführt wird, erhält uns das Wild als ein wertvolles Stück der heimatlichen Natur zur Freude nicht nur des Jägers, sondern jedes Naturfreundes, und da sich die Wildhege mit Erfolg immer nur in einem Gelände ausüben läßt, das noch bis zu gewissem Grade das Gepräge der Urwüchsigkeit zeigt – ursprüngliche Wälder, Brüche, Moore, Heiden – so haben wir es zu nicht geringem Teil der Jagd zu verdanken, wenn noch nicht überall die Ackerbausteppe und der durchforstete Nutzwald in unserm Vaterland herrschen, sondern auch noch ab und zu ein Stück Land ein mehr oder weniger[63] ursprüngliches Gepräge zeigt. Jagd und Jagdpflege sind der unbewußte Anfang des Naturschutzes und der Naturdenkmalpflege gewesen, und daher ist es die Pflicht des Heimatschutzes, die edle weidgerechte Jagd, deren Hauptaufgabe in der Hege und Pflege eines angemessenen Wildstandes besteht, hochzuhalten und alle jagdlichen Bestrebungen nach der gekennzeichneten Richtung hin zu unterstützen. »Jagdschutz« also auch in dem Sinne: »Schutz der Jagd!«
Ungleich zahlreicher noch als die Säugetiere sind die Vögel, die sich besonderer Volkstümlichkeit erfreuen und deshalb in vielen Märchen und Fabeln auftreten. Gleich jenen haben auch die Vögel ihren König, den Adler, nicht wie der Löwe ein Tier fremder Zonen, sondern ein Bewohner unsrer Heimat. Aber wie wenige meiner Leser werden den stolzen Vogel aus der freien Natur kennen! Bei uns in Deutschland stehen sämtliche Adler auf der Aussterbeliste. Der Steinadler horstet wohl noch in ein oder dem andern Paar in den bayrischen Alpen, während er in den Wäldern Ostpreußens seit Beginn unsers Jahrhunderts ausgerottet zu sein scheint. Und doch war dieser wahrhafte König der Lüfte noch vor hundert Jahren in manchem deutschen Mittelgebirge Brutvogel, ebenso weitverbreitet im Niederland, in Pommern, Westpreußen, der Mark so gut wie im Böhmer Wald oder im Riesengebirge.
Etwas besser steht es noch heute um See- und Fischadler; doch sind deren Horste an der Ostseeküste und auf der norddeutschen Seenplatte gleichfalls gezählt.[64] Den Nachstellungen des Menschen ist der König der Vögel zum Opfer gefallen. Auch in den Alpen ist der Anfang vom Ende da, gezählt sind die Tage seiner Herrschaft. In Sachsen horstet schon längst kein Adler mehr. Aber der Wanderzug führt stets noch einige Seeadler, auch Fischadler durch unser Land. Sie kommen von der Wasserkante oder weit aus den russischen Wäldern. Ein gefährlicher Flug ist's. Es vergeht kein Jahr, wo nicht ein oder der andere der stolzen Vögel von einem Schießer heruntergeknallt wird, der sich dann als kühner »Adlerjäger« brüstet.
Mit den nächtlichen Raubvögeln, den Eulen, hat sich die Märchen- und Fabeldichtung gleichfalls viel beschäftigt; Und das ist kein Wunder. Erst wenn die Dämmerung eintritt, beginnen die Eulen ihre Streifzüge. Dank ihrem seidenweichen Gefieder gleiten sie geräuschlos und deshalb geisterhaft an dem nächtlichen Wanderer vorüber, und unheimlich klagend heult ihre Stimme aus dem dunklen Walde. Gleich glühenden Kohlen funkeln die Riesenaugen im nächtlichen Schatten – wieviele Spukgeschichten mögen ihnen ihr Dasein verdanken! Das Märchen verwendet, um die Stimmung recht gruselig zu machen, die funkelnden Eulenaugen außerordentlich oft.
Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die eine besondere Vorliebe für diese unheimlichen Gespenstertiere besitzen. Das tut mir leid, einmal der Eulen wegen und dann auch um meiner selbst willen, da ich mich mit meiner ausgesprochenen Passion für Käuze und Eulen aller Art ziemlich vereinsamt fühle. Ein rechtes Verständnis für die Anmut der Eulen habe ich nur bei den Italienern gefunden; diese betrachten ihre Steinkäuzchen[65] als wirkliche Hausfreunde und richten dunkle Brutplätze unter den Dächern mit bequemen Eingängen für sie her. Allerdings ist ihre Vorliebe für Käuze nicht frei von Eigennutz; denn der Italiener bedient sich seiner Freunde zum Fang von Kleinvögeln. Auch die alten Griechen, denen Verständnis und Gefühl für Schönheit doch wahrhaftig nicht abgesprochen werden kann, erkannten die eigenartige Eulenschönheit. Die Eule war der Pallas Athene heilig, die selbst als »eulenäugig« bezeichnet wird; zugleich war sie das Wappentier der Hauptstadt, das Sinnbild der Weisheit, und sogar als Glücksbotin findet sie Erwähnung.
Wieviel könnten wir Deutschen doch von den alten Griechen in dieser Beziehung lernen! Bei uns heißt es: »Häßlich wie eine Nachteul'«, und Eulenaugen gelten nicht gerade als Schönheit. Dazu ist die Eule in deutschen Landen so recht der Unglücksvogel, dessen nächtlicher Ruf Krankheit und Tod kündet. Auch im deutschen Märchen ist der Kauz viel weniger der Vogel der Weisheit, als der böse Geist, der Dämon, der Hüter verborgener Schätze, dem Menschen feindlich gesinnt, vertraut mit der schwarzen Kunst, mit Zauberei; in der Fabel aber ist er ein Griesgram und rechter Philister.
Ebenso bedauerlich wie auffallend ist der Rückgang der Eulen in unsrer Heimat. Von dem Uhu will ich nicht reden – das letzte Paar brütete noch um die Wende unsers Jahrhunderts in den Felswänden des Hohnsteiner Reviers. Ich fürchte, der Schutz, den man heute in allen Staatsforsten dem seltenen Räuber gern gewähren möchte, kommt bereits zu spät, um den »König der Nacht« zu retten. Aber auch die mittelgroßen Eulen, wie Wald- und Schleierkauz, Wald- und[66] Sumpfohreule, selbst die kleinen Käuzchen sind heutzutage viel seltener geworden als zu meiner Jugendzeit. Man mag eine Eule aus dem Gehöft verjagen, wenn man den Mäusejäger durchaus glaubt entbehren zu können; aber eine Eule töten, bleibt eine Roheit und Gemeinheit, wenn auch vor unsern ganz unzureichenden sächsischen Gesetzen der Frevler frei ausgeht. Alles, was bewehrte Fänge und einen Krummschnabel trägt, gehört in Sachsen zu den jagdbaren Vögeln, und auf diese findet das deutsche Reichsgesetz keine Anwendung. Der Freibrief, den dieses mit Recht dem Turmfalken, dem Schrei- und Seeadler, dem Bussard, der Gabelweihe und sämtlichen Eulen, mit Ausnahme des Uhus, ausstellt, hat also für Sachsen keine Gültigkeit. Hierin endlich einmal Wandel zu schaffen, ist eine dringende Forderung des Naturschutzes an die Gesetzgebung.
Viel mehr als die lichtscheue Eule ist im deutschen Märchen der Rabe der Vogel der Weisheit. Er hat die Gabe, in die Zukunft zu schauen und wird so zum Verkünder kommender Ereignisse. Das hängt zweifellos damit zusammen, daß bei unsern Altvordern der Rabe der Vogel Wodans war, der Götterbote, der den Verkehr zwischen dem Herrscher des Himmels und den Bewohnern der Erde vermittelte. Seine Verwandten, die Krähen und Elstern, gelten als diebisches, zänkisches Gesindel, letztere als besonders schwatzhaft.
Ein anderer Götterbote war der Storch; doch spielt dieser in orientalischen Erzählungen und Märchen eine weit größere Rolle als in unserm deutschen Märchenschatz. Auch in der deutschen Fabel begegnet man dem klappernden Hausfreund nur selten. Dagegen hat unser[67] Volk um Leben und Treiben des Storchs einen reichen Kranz abergläubischer Vorstellungen gewunden, deren Ursprung sich in graue Vorzeit verliert.
Unter den Wasservögeln ist wohl der Schwan das vornehmste Märchen- und Sagentier. Wir denken an das lustige Märchen »Schwan, kleb an!«, an die reizende Geschichte vom kleinen »häßlichen Entlein«, das aber einem Schwanenei entschlüpft war und bald zum bildschönen Schwan heranwuchs; wir denken an Lohengrins Schwan und an die Schwanenritter oder an die Schwanenjungfrauen, die auf der Donau den Nibelungen erschienen und sie vor der Fahrt warnten, die allen den Untergang bringe. In Sachsen brütet der Wildschwan leider nirgends; dazu sind unsre Teiche zu klein und unsre Elbe mit ihren gemauerten Ufern viel zu nahrungsarm und zu unruhig. Wer aber die ostpreußischen Seen kennt, der wird sich mit Freude der anmutigen Schwimmvögel erinnern, die so manchem dieser Gewässer einen besonderen Schmuck verleihen. Auch Seen in Brandenburg und Mecklenburg oder der Unterlauf der Warnow unterhalb Rostock beherbergen noch immer eine erfreuliche Anzahl der stolzen Geschöpfe. Freilich haben die bösen Verhältnisse der Nachkriegszeit auch in ihre Reihen starke Lücken gerissen, so daß es ernstlich an der Zeit ist, für den Schutz dieser Tiere zu sorgen. Besonders lieblich sind die Familienbilder, die sie zu Sommers Anfang dem Beschauer bieten, wenn die Schwanenmutter ihre Kleinen das erstemal durchs Schilf auf die freie Wasserfläche führt oder die grauen Dunenbällchen auf den Rücken nimmt und mit dieser leichten Bürde zurück zum Neste gleitet.
An zweiter Stelle wäre auch der Gänse zu gedenken.[68] Unsre geliebte Hausgans, deren Braten alljährlich an meinem Namenstage so manchen Mittagstisch verschönt – im vorigen Jahre nach längerer Pause auch den meinen, da eine freundliche Fee den köstlichen Vogel in mein Haus flattern ließ – stammt von der Graugans her, die gleichfalls noch in Norddeutschland brütet und gelegentlich ihrer Herbstreisen auch an unsre sächsischen Gewässer kommt. Sie ist eleganter in der Figur, als unsre Haus- und Hofgenossin, auch leichter im Flug, gewandter im Schwimmen; denn das Gänsefett belästigt sie nicht so stark wie jene. Auch die Ente mit dem goldnen Krönchen erscheint im Märchen, und in der Fabel tritt sie zumeist mit dem Fuchs auf, der ihr den Kragen umdrehen möchte.
Unter den Singvögeln sind vielleicht die volkstümlichsten Nachtigall und Lerche. Ihr Gesang hat von jeher den Menschen begeistert. In hundert Volksliedern wird die Nachtigall erwähnt, ja bei den Minnesingern, die sich nicht genug tun können, die kleinen Waldvöglein zu preisen, ist die Sängerin der Nacht so ziemlich der einzige Vogel, der mit Namen genannt wird. Die Lerche aber ist die Sängerin des Tages, die zum Licht emporsteigt, die mit der Morgenröte sich erhebt, um den ganzen Himmelsraum mit ihrem Jubel zu erfüllen, zum Preise des Schöpfers. Neben ihnen spielen in Märchen und Fabeln die andern Kleinvögel, wie Zeisig, Rotkehlchen, Zaunkönig und Star, nur bescheidene Rollen; sie treten in der Regel nicht allein auf, sondern in Begleitung jener Sänger. Ich erinnere an die Fabeln vom Zeisig, vom Kuckuck oder auch vom Wiedehopf und der Nachtigall, von der Schwalbe und der Lerche.
Die Schwalbe ist der Vogel, der das innigste[69] Bündnis mit dem Menschen geschlossen hat; denn während recht viele zutrauliche Vögel wohl die Nähe menschlicher Siedlungen aufsuchen und ihre Wohnung an unsern Häusern, auf und unter dem Dach, am Gesims, auf einem Balkenkopf oder in irgendeinem versteckten Winkel aufschlagen, sind es die niedlichen Rauchschwälbchen mit dem gabelartig verlängerten Schwanz und der rostroten Stirn, die fast ausnahmslos im Innern der Gebäude Herberge nehmen. Dem Tragbalken des Vorhauses, der Decke des Kuh- oder Pferdestalles, wohl auch dem Schirm einer elektrischen Lampe vertrauen sie ihr Nestchen an. Und solche Anhänglichkeit an uns Menschen verdient Gegenliebe, wie man sie allgemein in deutschen Landen den lieblichen Vögelchen entgegenbringt. Eine Schwalbe zu töten oder auch nur ihr Nest zu zerstören, ist ein schwerer Frevel, der von der rächenden Gottheit mit langem Siechtum bestraft wird. Wo die glückverheißenden Vögel den Hof verlassen haben und im kommenden Frühjahr nicht wieder Einkehr halten, da zieht Unfrieden im Haus ein oder es stirbt ein Bewohner. Wer möchte es wünschen, daß solch frommer Aberglaube doch endlich in die Rumpelkammer längst überlebter mittelalterlicher Vorstellungen, die nicht mehr in unsre aufgeklärte Zeit passen, geworfen werde!
Sinnig sind manche Sagen, die von der Schwalbe berichten. Bei der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies flog eine Schwalbe blitzschnell an dem Flammenschwerte des zürnenden Engels vorüber, um das arme, verstoßene Menschenpaar in seine neue unbekannte Heimat zu begleiten. Hier ward sie ihm zur treuesten Freundin im Glück und im Unglück. Eine andere Sage erzählt: Als Christus am Kreuze hing und, vom Durst[70] gequält, um Wasser flehte, da hörte eine Schwalbe des Heilands Bitte: »Mich dürstet«. Schnell eilte sie an eine Quelle, küßte dann des Sterbenden Lippen und träufelte einige Tropfen Wasser auf sie. Hierauf umflog sie das Haupt des Heilands, mit ihren langen Schwingen ihm Kühlung zufächelnd. Dabei streifte sie die blutenden Wunden, so daß sich Stirn und Kehle rot färbten. Ähnliches weiß die Sage auch vom Kreuzschnabel zu erzählen. Bei dem Versuch, die Nägel aus dem Kreuzesstamm zu zerren, hat sich sein Schnabel verbogen, sein Gefieder gerötet.
Nur ein Wort noch vom Wiedehopf. Er steht nicht im besten Geruch und ist doch mit seiner Federholle und dem ansprechenden Farbenkleid ein wunderhübscher Vogel. Heute kenne ich den Wiedehopf als sächsischen Brutvogel nur aus der Lausitz, wo er allerdings außerordentlich selten ist. In meiner Jugendzeit aber brüteten alljährlich mehrere Paare in den alten Kirschbäumen, die die Viehweide des Rittergutes meiner Heimat umgaben. Ein ganz abscheulicher Gestank, wenn man die Nase in den Eingang solcher Kinderstube bringt; selbst die ausgeflogenen Jungen müssen sich noch tagelang gewissermaßen auslüften, ehe sie den Geruch verlieren, so fest sitzt er ihnen im Gefieder. In der Fabel ist der Wiedehopf seines gekrönten Hauptes wegen der eitle Vogel, dessen armseliger Ruf sich mit dem Gesang der unscheinbaren Nachtigall nicht messen kann.
Die Zahl der Vögel, die das Märchen, ganz besonders aber die deutsche Fabel auftreten läßt, ist so groß, daß man leichter die Arten aufzählen könnte, von denen das Volk nichts zu erzählen weiß. Kuckuck und Pfau, Hahn und Sperling, Wachtel und Taube, Kranich und[71] Reiher, Gimpel und Zeisig müßte ich nennen, und ich würde noch keineswegs allen gerecht werden. Gerade der Vogel ist von jeher der Liebling des Menschen gewesen; seine anmutige Gestalt, sein hübsches Farbenkleid, vor allem aber seine Stimme haben von Anfang an die Aufmerksamkeit eines jeden auf ihn gelenkt.
Die kaltblütigen Wirbeltiere stehen unserm Volke nicht so nahe; das Verhältnis zu ihnen ist weniger innig. Ganz besonders gilt das von den Fischen. In dem deutschen Märchen spielen sie eine nur sehr bescheidene Rolle, und auch in den Fabeln tritt nur hie und da mal der gefräßige Hecht oder der stumpfsinnige Karpfen auf. Die Fische haben wenig zu sagen, sie sind stumm; daraus erklärt sich wohl solche Vernachlässigung.
Aber unter den Lurchen gibt es ausgezeichnete Sänger, die mit ihrem Lied die ganze Frühlingsnacht erfüllen: die Frösche sind es. Unsern Seen- und Teichlandschaften verleiht ihr Chorgesang einen ganz eigentümlichen Reiz. Freilich handelt es sich dabei nur um die eine Art, den grünen Wasserfrosch, während man von dem andern, dem braunen Grasfrosch, der auf der feuchten Wiese oft in großer Anzahl vor unsern Schritten aufspringt, nur selten einen knurrenden Laut vernimmt; rana muta, d. i. der Stumme, nannte ihn deshalb der Zoolog. Um so lebhafter der andere, der Wasserfrosch. Er ist es, von dem das Märchen so viel zu erzählen weiß, von seinem Schloß tief unten im feuchten Element, wo der Froschkönig sein Reich aufgeschlagen hat und seine Herrschaft über die ganze pausbäckige[72] Gesellschaft ausübt. Meist handelt es sich um Verwandlungsmärchen, um einen Fürstensohn, der in einen Frosch verzaubert ward und dann durch die Guttat eines Menschenkindes erlöst wird. Oder ich erinnere an Georg Rollenhagens »Froschmäuseler« aus dem Jahre 1595, ein langatmiges Reimwerk, dem Homers »Froschmäusekrieg« zur Grundlage diente. Die ganze wunderliche Hofhaltung der Frösche und Mäuse wird uns hier geschildert und die blutige Schlacht zwischen den Bewohnern des Wassers und den kleinen graufelligen Nagern des Feldes. Und dann, wieviel alte und neue Fabeln handeln doch von dem kaltblütigen Sänger, der bald mit der Nachtigall, bald mit dem Kuckuck den Wettgesang anstimmt!
Auch die Kröte mit der goldenen Krone ist eine Märchengestalt, die auf Erlösung harrt. Ich glaube, ihr schönes goldenes Auge, das treuherzig blickt, voll Wehmut und Sehnsucht, hat es dem Menschen angetan. Wer es fertig bringt, eine Kröte in roher Weise zu töten, muß bar jedes Gemüts sein.
Von den Schlangen ist im Märchen manchmal die Rede. Sie sind die Behüterinnen verborgener Schätze oder werden nur nebenbei erwähnt, um die gruselige Stimmung, die einsame, dunkle Orte dem Menschen einflößen, noch zu erhöhen. Selten wird eine bestimmte heimische Schlangenart genannt, auch die giftige Kreuzotter nicht. Dagegen tritt unter dem Namen »Hausunke« die Ringelnatter auf; ihre gelblichen oder weißen Halbmondflecken am Hinterkopf und Hals werden als Krone gedeutet.
Es würde zu weit führen, auch den wirbellosen Tieren unsre Aufmerksamkeit zu widmen. Auch von[73] ihnen gibt es recht viele, die wahrhaft volkstümlich geworden sind und besonders in der deutschen Fabel häufig auftreten. Ich erinnere nur an Ameise, Biene, Feldgrille, Heupferd, Leuchtkäfer oder an die Schnecke.
Schutz der Tierwelt! Es wird so viel darüber geklagt, daß die großen Tiere der Tropen und der Polarzonen durch die unsinnige Jagdleidenschaft der weißen Rasse ihrem Untergang mit Riesenschritten entgegeneilen, daß die Elefanten, Giraffen und Flußpferde, ebenso die großen Walsäugetiere oder die Büffel, die einst in ungeheuren Scharen die weiten Ebenen Nordamerikas belebten, recht bald der Vergangenheit angehören werden. Und nicht etwa nur die wirtschaftliche Einbuße und der Verlust, den die Wissenschaft dadurch erleidet, rechtfertigen diese Klage und Anklage, sondern der Frevel an der Natur ist es, der das Herz eines jeden mit Bitterkeit und Trauer erfüllt. Aber näher doch als jene Tiere ferner Zonen sollte uns die heimatliche Tierwelt stehen. An ihrer Erhaltung ist nicht etwa nur dem einzelnen Naturfreund gelegen, sondern unserm ganzen Volk im allerweitesten Sinne. Wir dürfen nicht engherzig nach Nutzen und Schaden fragen, sondern die höheren Tiere sind mit ganz wenig Ausnahmen – ich denke z. B. an die Kreuzotter oder an kleine Säugetiere, die namentlich auf den Feldern als verheerende Landplage auftreten können – um ihrer selbst willen des allgemeinen Schutzes wert. Wenn wir aber aus der großen Masse einige besonders hervorheben wollen, deren[74] Untergang am meisten beklagenswert wäre, ein unersetzlicher Verlust nicht nur für die deutsche Landschaft, sondern für unser ganzes Volk, so sind es die volkstümlichen Tiere der deutschen Märchen und Fabeln.
Die Ziele und Bestrebungen der Menschen sind verschieden und müssen es sein. Was bringt mir Nutzen und Gewinn? was ist für mich persönlich von Vorteil? was kann mir schaden? was steht mir im Wege, mein Ziel zu erreichen? Das sind die täglichen Fragen des einzelnen.
Aber der einzelne vermag wenig. Gleichgesinnte haben sich deshalb zu Verbänden zusammengeschlossen, um mit vereinten Kräften das gemeinsame Ziel zu verfolgen. Solcher Vereine oder Verbände gibt es unzählige, und wo sie lediglich äußere Vorteile im Auge haben, wo die Frage nach Nutzen und Schaden im Vordergrund steht, da kreuzen sich ihre Interessen vielfach, und es treten Gegensätze hervor, die oftmals zu erbitterten Kämpfen führen.
Der Landwirt, der Jäger, der Fischzüchter, der Obstgärtner, der Imker u. a., sie glauben ein Recht zu haben, mit allen Mitteln die Ziele zu verfolgen, die ihnen ihr Beruf setzt. Sie vergessen aber nur zu leicht dabei die Rücksichtnahme, die sie ihren Mitmenschen schuldig sind, und nicht nur diesen, sondern unserer gemeinsamen Mutter, der Natur, der wir alles verdanken.
Der Jäger sucht die Feinde seines sorgsam gehegten Wildstandes unschädlich zu machen; er stellt also auch[76] den Raubvögeln nach, deren herrlicher Flug das Auge und Herz des Naturfreundes erfreut, und er fragt wenig danach, ob er dadurch den Landwirt schädigt, zu dessen treuesten Verbündeten im Kampfe gegen die Mäuse gerade sehr viele Raubvögel gehören. Der Fischereiberechtigte leidet den farbenprächtigen Eisvogel nicht und fängt ihn in kleinen Tellereisen, obgleich die Vogelfreunde sich bemühen, diesen herrlichen Edelstein der heimatlichen Vogelwelt vor völligem Untergang zu bewahren, oder er setzt Prämien für die Erlegung des Fischadlers und anderer Fischfeinde aus, bepelzt und befiedert, deren Vernichtung auch die Wissenschaft beklagen muß, sobald es sich um seltene Naturdenkmäler handelt. Der Bienenzüchter ist den Meisen und Rotschwänzchen feindlich gesinnt, die ihm manche Biene wegschnappen; er vergißt dabei, daß gerade diese Vögel dem deutschen Forstmann wie dem Obstgärtner von allergrößtem Nutzen sind. Der Pächter von Kirschplantagen klagt darüber, daß der Vogelfreund den Star durch Aushängen von Nistkästen in mancher Gegend unseres Vaterlandes in einer Weise vermehrt habe, daß die Kirschenernte durch diesen Vogel arg geschmälert werde. Die Katze, die dem Gutsbesitzer unentbehrlich ist, wird geschossen, wenn sie sich am Waldrande zeigt, oder der Vogelschützler fängt sie in der Falle, die er in seinem Garten aufgestellt hat. Und so geht es weiter: überall Gegensätze, überall Meinungsverschiedenheiten zwischen den Jagdschutz-, Fischereischutz-, Vogelschutz-, Obstbau-, Bienenzüchter-, Gärtner-, Naturschutzvereinen und ihren einzelnen Vertretern, und jeder glaubt im Recht zu sein, wenn er sich über die Handlungsweise des Nachbarn bitter beklagt.
Und doch, nur ein klein wenig gegenseitiges Verständnis, ein wenig Rücksichtnahme, freundliches Entgegenkommen von der einen Seite wie von der andern: wahrhaftig, mancher Streit könnte beigelegt, mancher Zusammenstoß gemildert werden. Wir wollen doch nicht ganz aufgehen in unsern persönlichen Interessen, nicht immer nur nach Nutzen und Schaden fragen, nach eignem Vorteil und Gewinn. Auf eine höhere Warte müssen wir uns stellen und das große Ganze überblicken, nicht den einzelnen im Auge haben, sondern die Gesamtheit. So verschieden die Bestrebungen und Ziele auch sein mögen: in dem einen großen und idealen Ziele finden wir uns schließlich doch alle zusammen: die Natur unsrer Heimat möchten wir so gern in ihrer heiligen, unverletzlichen Schönheit erhalten wissen, soweit es ohne wesentliche Schädigungen berechtigter Sonderinteressen nur irgend möglich ist. Schutz unsrer Heimat! das muß unsre Losung sein; alles andre hat sich diesem allgemeinen Ziel unterzuordnen.
Wer den großen, gar nicht hoch genug einzuschätzenden Vorzug besitzt, daß ihn sein Beruf in die innigste Berührung mit der Natur bringt, der darf nie vergessen, daß er dieser unsrer Allmutter, wie seinen weniger begünstigten Mitmenschen gegenüber Verpflichtungen schuldet, die den eignen persönlichen Interessen vorangehen. Und so sollten sich all diese Begünstigten die Hand zum Bunde reichen und sich zusammenfinden in der Idee des Heimatschutzes, der kein kleinliches Partei-, kein einzelnes Berufsinteresse kennt. Die gefährdeten Geschöpfe unsrer Heimat gilt es zu erhalten, nicht zu vernichten! Wir haben kein Recht, die Natur[78] zu verstümmeln. Wir wollen uns nicht nur der nützlichen und harmlosen Tiere annehmen, sondern auch derjenigen, die sich in vielen Einzelfällen als schädlich erweisen, und wollen diese wenigstens soweit dulden, daß sie nicht völlig von der Bildfläche des Lebens schwinden – unrettbar, unwiederbringbar!
Die Fischerei hat über die Menge der tierischen Feinde vielleicht noch mehr zu klagen als die Jagd. Dabei wollen wir die kleineren Räuber, die den Kerbtieren angehören, ganz unberücksichtigt lassen: den Gelbrand und seine Larve, die nicht nur die junge Brut überfallen, sondern sich auch nicht scheuen, mit ihren scharfen Freßwerkzeugen selbst größere Fische anzubeißen, oder den Rückenschwimmer, auch Wasserwanzen und Wasserskorpion, ebenso die äußerst räuberischen Larven mancher anmutigen Libellen, die als fertige Insekten zu den harmlosesten Tieren gehören. Wir wollen nur an die vielen Fischfeinde oder, besser gesagt, an die Fischliebhaber denken, die dem Fischereiberechtigten aus der Reihe der Wirbeltiere mancherlei Schaden verursachen.
Ein wirkliches Raubtier, der Fischotter, der Familie der Marder angehörend, ist wohl am meisten gefürchtet. Töricht und ungerechtfertigt wäre es, vom Fischereiberechtigten zu verlangen, diesen bösen Fischräuber unbehelligt zu lassen. Wo er sich in unsern Teichgebieten zeigt, die vornehmlich der Karpfen- und Schleienzucht dienen, da bleibt dem Besitzer oder Pächter gar nichts anderes übrig, als den Otter im Eisen zu fangen oder auf dem Anstand zu schießen oder auch durch scharfe[79] Otterhunde und Teckel ihn in seinem Bau aufzustöbern; denn der Schaden, den der gewandte Schwimmer hier anrichtet, ist unberechenbar groß, zumal der Fischotter ungleich mehr Fische vernichtet, als er zu verzehren vermag. Auch den Möweneiern, der Kiebitzbrut, jungen Gänsen und Enten, zahmen wie wilden, stellt der mordgierige Räuber nach. Aber es gibt doch auch Gewässer in unserm Vaterland, Flüsse und Bäche, wo von größerem Fischreichtum nie die Rede sein kann. Wenn sich hier 'mal ein Fischotter zeigt und der Fischereiberechtigte fängt nun an zu rechnen: 6 Pfund Fische täglich zum Fraß und noch doppelt so viel aus reiner Mordlust, macht 18 Pfund auf den Tag oder 65 Zentner im Jahre; alles halbpfündige Forellen vielleicht – mir schwindelt der Kopf, wenn ich dran denke, wieviel Tausende Papiermark das ausmacht: so ist solches Rechenwerk einfach lächerlich; denn so viel Fische beherbergt der ganze Fluß nicht, selbst wenn man die winzigsten Schneider mitrechnet. Oder hofft der Fischer etwa, wenn er den Übeltäter erst 'mal hat nun die 65 Zentner Fische selbst einheimsen zu können? Vergebliche Hoffnung! Zu fischreichen Gründen, wie sie es vielleicht ehemals waren, als die Fabriken durch ihre Abwässer den Flußlauf noch nicht verunreinigt hatten, werden derartige Gewässer niemals wieder sich umwandeln, ob man den Otter gewähren läßt oder ihn wegfängt.
Zum Glück ist der Herr der Seen und Flüsse ein kluges Geschöpf, vorsichtig, mißtrauisch; die geringste Veränderung in der Nähe seines Baues und Ausstieges bemerkt er sofort, und so müht sich der Fänger in vielen Fällen vergeblich ab, den Fischräuber zu überlisten. Wir dürfen hoffen, daß das interessante »Fischsäugetier«[80] unserer Heimat trotz aller Nachstellungen, wenn auch in verschwindend geringer Anzahl, erhalten bleibt.
Auch die Verwandten, die Mitglieder der eigentlichen Marderfamilie, stellen gelegentlich den Karpfen und Schleien und selbst den flinken Forellen nach. Gute Schwimmer sind sie alle, und was sie erreichen können zu Land und zu Wasser, wird erbarmungslos gemordet. Aber gerade die Vielseitigkeit ihres Speisezettels – Eichkatzen, Wildtauben, Häher, Krähen, allerlei Kleinvögel und ihre Eier, Mäuse und Frösche, Ratten, Junghasen, Kaninchen, Fasanen, Eidechsen, Fische, Maikäfer usw. – beweist, daß sowohl die größeren Arten, Baum-, Hausmarder und Iltis, als auch die kleineren, Hermelin und Mauswiesel, neben beträchtlichem Schaden, den sie vor allem der Niederjagd zufügen, doch auch manchen Nutzen stiften. Wo sie sich zu stark vermehren, da soll man ihnen Einhalt gebieten; aber sie auszurotten, wäre eine sehr bedenkliche Maßnahme. Mäusefraß und Rattenschaden, übermäßige Vermehrung der Eichhörnchen oder auch der Krähen und Wildtauben würden solchen Weltverbesserern beweisen, daß sie auf dem Holzwege sind.
Auch die kleine Wasserspitzmaus wird des Fischraubes beschuldigt, und gewiß mag ihr manche Elritze, mancher Stichling zum Opfer fallen; aber wenn man bedenkt, daß die flinken, ewig hungrigen Spitzmäuse jedes Tier auffressen, das sie überwältigen können, Schnecken, Egel, Libellen- und Schwimmkäferlarven, Flohkrebse, Uferwanzen, Heuschrecken, Regenwürmer, Raupen, Larven von Köcherfliegen u. a., wird der Fischpächter versöhnlicher gestimmt werden und den kleinen muntern Schwimmern auch 'mal ein Fischchen gönnen.
Über die Wasserratte, die im Gegensatz zu den bisher genannten Fleisch- und Insektenfressern zu den Nagetieren zählt, sind die Ansichten geteilt. Die einen meinen, die Wasserratte rühre kein Fischlein an; andere dagegen behaupten, kleine Fische fielen ihr häufig zum Opfer, und wo Fischzucht getrieben wird, dürfe es daher keine Wasserratten geben. Allzugroß wird der Schaden jedenfalls nicht sein, zumal der Nager durch den Fang fischfeindlicher Wasserinsekten manchen Verlust wieder auszugleichen mag.
Aber gefiederte Fischräuber gibt es viel mehr als bepelzte – leider, leider! Man kann es den Fischereiberechtigten wirklich nicht verargen, wenn sie sich gegen die Konkurrenz, die ihnen von dieser Seite zweifellos in oft recht empfindlicher Weise gemacht wird, zur Wehr setzen. Auf der andern Seite sind gerade unter diesen gefiederten Fischliebhabern einige, die zu den schönsten Mitgliedern der Vogelwelt gehören und unsern Teich- und Seenlandschaften zum reizvollsten Schmuck gereichen, so daß deren Verfolgung den Naturfreund außerordentlich schmerzlich berühren muß. Hier ist eine Verständigung sehr schwierig. Es muß der Fischer dem Vogelfreund ein wenig entgegenkommen, und dieser jenem. Schon wenn jeder sich bemüht, den Standpunkt des andern zu verstehen und zu würdigen, wird viel gewonnen sein.
Ich denke, man sollte zunächst einmal unterscheiden, ob es sich um einzeln lebende Fischräuber handelt, z. B. den Fischadler, den Schwarzstorch, den Eisvogel,[82] die also mehr oder weniger als Einsiedler hausen und ein weites Revier für sich beanspruchen, oder um solche Vögel, die in größerer Menge auftreten, wie Reiher, Möwen, Taucher u. a. Bei jenen darf man wohl erwarten, daß der einsichtsvolle Fischer, dem doch auch die Erhaltung der heimatlichen Natur am Herzen liegt, ein Auge zudrückt, falls die Verhältnisse nicht besonders ungünstig sind; es kann ja hier höchstens von einem örtlichen, nicht aber von einem allgemeinen Schaden die Rede sein. Bei den in größerer Anzahl auftretenden Schädlingen aber sollte man sich damit begnügen, sie auf ein gewisses Maß zu beschränken. Und dieses Maß, das nicht überschritten werden darf, scheint mir allerdings für manche Gegend bereits erreicht zu sein. Indessen allgemeine Regeln, die in jedem Einzelfall zu beachten sind, lassen sich nicht aufstellen.
Wer den Eisvogel aus dem Bereich der Fischzuchtanstalten vertreibt, dem wird man es nicht verargen können; denn wo diese gefiederten Fischer in größerer Anzahl regelmäßig bestimmte Setzteiche besuchen, da wird der Schaden nicht unerheblich sein, obgleich sie nur kleinfingerlange Fischchen erbeuten. Solche Fälle aber sind Ausnahmen. Jedes Pärchen beansprucht ein großes Gebiet und duldet kein zweites in unmittelbarer Nähe. Und gerade in unserer Heimat sind die Eisvögel bereits so selten geworden, daß ich nicht weiß, ob jeder meiner Leser schon einmal in freier Natur den leuchtenden Funken, rotgoldig glänzend und seidig blau, an sich hat vorüberschießen sehen, oder ob er ihn nur im ausgestopften Zustande kennt. Jedenfalls ist es selbst für den, der mit der gefiederten Welt der Heimat vertraut ist, immer ein Ereignis, wenn er dem Eisvogel an unsern Bächen,[83] Flüssen und Teichen begegnet. Ihn überall, wo er sich zeigt, wegzuknallen oder in kleinen Tellereisen zu fangen, ist eine Versündigung an der Natur. An unsern Gebirgsbächen, an unsern Flüssen, an allen Teichen, die nicht gerade der Fischzucht dienen, sollte man den einsamen Fischer ruhig gewähren lassen. Oder ist wirklich jemand der Meinung, der Eisvogel trage die Schuld, daß die heimatlichen Gewässer so arm an Fischen sind?
In dem überaus heißen und regenarmen Sommer des Jahres 1911, wo bei uns alle Quellen versiegten, jedes Bächlein, jeder Graben austrocknete, da sammelten sich einige Eisvögel an dem einzigen größeren Bach meiner Heimat, der noch etwas Wasser führte; der Hunger trieb sie hierher. Aber dem Tode entging vielleicht keiner; man schoß ab, so viel man erreichte. Wozu? Hier, wo von gewinnbringender Fischerei nicht die Rede sein kann, wo nur gelegentlich ein paar Forellen gefangen werden, hätte man doch wahrhaftig den schönen Vögeln den kleinen Tribut gönnen können, den sie beanspruchten; nach kurzer Zeit würden sie sich wieder über ein weites Gebiet, aus dem sie die Trockenheit vertrieben hatte, verstreut haben. Ist der Fischereiberechtigte der sogenannten wilden Fischereien wirklich in so bedrängten Verhältnissen, daß es ihm auf ein paar winzige Fischchen ankommt? so fragt man sich. Nimmt er lieber den Unwillen der vielen Naturfreunde, die solche Handlungsweise mit Recht verurteilen, auf sich, als daß er auf eine kleine Anzahl zum Teil fast wertloser Schuppenträger verzichtet? Man möchte solch engherzigem Pfennigrechner den geringen Verlust gern aus eigner Tasche ersetzen.
Und nun die weitere Frage: Hat der Fischereipächter[84] ein gesetzliches Recht, den Eisvogel zu töten? Nach dem deutschen Vogelschutzgesetz ist der Eisvogel ebenso geschützt wie jeder Singvogel. Bei uns in Sachsen wird er laut eines Beschlusses des Finanzministeriums vom 3. Juni 1912 als jagdbar angesehen, »da er wirtschaftlich wesentlich schädlich« sei3; doch soll er die allgemeine Schonzeit vom 1. Februar bis mit 31. August genießen. Die Dienststellen der Forstverwaltung sind angewiesen, ihn durchaus zu schonen. In Preußen dürfen die Fischereiberechtigten den Eisvogel ohne Anwendung von Schußwaffen fangen und töten, in Sachsen nicht. In Bayern aber, in Württemberg, Baden, Mecklenburg und in fast allen andern deutschen Einzelländern ist der Eisvogel unbedingt geschützt. Man ist sich in vielen Kreisen über diese rechtliche Stellung unseres Vogels noch gar nicht im klaren.
3 Nach meiner persönlichen Auffassung ist dieser Beschluß nicht haltbar. Alle »kleinen Feld-, Wald- und Singvögel« sind vom Jagdrecht ausgenommen. Zugegeben auch, daß der Eisvogel unter diesen Begriff nicht recht zu bringen ist, ein »Wasservogel« – und als solcher nur wäre er jagdbar – ist er aber gleich der Bachstelze und der Wasseramsel doch nur im biologischen, nicht im systematischen Sinne. Und daß Nutzen oder Schaden bei der Beurteilung, ob jagdbar oder nicht jagdbar, berücksichtigt werden sollen, davon sagt das Gesetz nichts.
Sehr bedauerlich ist es auch, daß oftmals lediglich die hervorragende Schönheit des Vogels den Anreiz zu seiner Verfolgung gibt, wie es auch von der Mandelkrähe, dem Pirol und andern auffallend gefärbten Vögeln gilt, die man doch gerade ihrer Schönheit wegen besonders schonen sollte – »Schönheit« und »schonen« sind sprachlich verwandte Wörter! Jede Schule ist stolz darauf, wenn sie unter ihren Anschauungsobjekten auch[85] einen Eisvogel besitzt, und als vor einigen Jahren die Mode aufkam, die Schüler im Zeichenunterricht ausgestopfte Vögel zeichnen und malen zu lassen – wie kann ein ausgestopfter Vogelbalg das Leben in freier Natur ersetzen! – da war die Nachfrage nach Eisvögeln besonders stark, und trotz aller Schongesetze wurde unter den prächtigen Vogelgestalten tüchtig aufgeräumt. Wenn der Bestand der gefiederten Fischer weiter in dem Maße abnimmt, wie innerhalb der letzten 30 bis 40 Jahre, so wird der schöne Vogel in kurzer Frist, bei uns wenigstens, nur noch der Sage angehören, und die Enkel, die vielleicht in der »guten Stube« der Großeltern den ausgestopften Eisvogel bewundern, wie er da zwischen den goldumrandeten Tellern und Tassen im Glasschrank seinen Platz gefunden hat, werden es nicht glauben wollen, daß solch herrliche, tropisch gefärbte Vögel einstmals in unsrer Heimat gelebt haben. »Warum schoß man sie ab?« so fragen die Enkel dann, »was taten sie den bösen Menschen zuleide?« »»So manches Fischlein holten sie sich aus Bächen und Flüssen; da ließ man keinen am Leben!««
Es nützt wenig, den Fischpächter darauf hinzuweisen, wie doch auch der Eisvogel gerade für ihn, den Fischer, einigen Nutzen stiftet, indem er allerlei Kerbtiere und deren Larven wegfängt, die der Fischerei großen Schaden zufügen; man denkt immer nur an die Konkurrenz durch den gefiederten Fischer. Gewiß, seine Hauptkost bilden die kleinen Flossenträger, die er, von seinem Sitzplatz aus eräugt und nun, ins Wasser hinabstürzend, zu fassen sucht. Aber nicht immer wird ihm ein Fisch zur Beute; oft ist's nur ein grauer Rückenschwimmer oder die Larve einer Wasserjungfer, einer Köcherfliege, die er erwischt;[86] noch öfter aber geht der Stoß fehl. Sehr genaue Forschungen über die Nahrung der Eisvögel hat Liebe angestellt. Die Untersuchung des Kropfinhaltes ergab, daß bei 78 v. Hdt. Fischreste, bei 22 aber die Reste von Kerbtieren überwogen. Damit stimmen auch die Magenuntersuchungen Ecksteins überein, der in 34 Magen Fischreste, in 12 Magen Insektenteile fand. Namentlich wenn der Eisvogel Junge im Nest hat, treibt er eifrig Kerbtierfang; denn zunächst füttert er die Kleinen mit Insekten und deren Brut, erst später mit Fischen aller Art. Daß er mit Vorliebe kleine Forellen fange, ist eine grundlose Behauptung.
Wirklich nachweisbaren Schaden wird der Eisvogel nur dort anrichten, wo künstliche Fischzucht getrieben wird, außerdem wo er an reichen Fischgewässern ausnahmsweise einmal in größerer Anzahl auftreten sollte. Wenn ihn der Fischereiberechtigte, namentlich der Forellenzüchter, an solchen Stellen zu vertreiben sucht, wird kein verständig Urteilender etwas einzuwenden haben, und wir sollten meinen, wie in Weinbergen und Kirschplantagen der Gebrauch des Schießgewehrs zur Abwehr der Vögel gestattet werden kann, so dürfte es zweckmäßig sein, wenn die Polizeibehörde – der Stadtrat bzw. die Amtshauptmannschaft – ermächtigt würde, die gleiche Erlaubnis den Besitzern von Forellenzuchtanstalten in bezug auf den Eisvogel zu erteilen, natürlich nur nach gründlicher Prüfung jedes Einzelfalles und bloß auf eine bestimmte kurze Zeit. Ganz verwerflich aber ist es, den herrlichen und bei uns in Sachsen schon recht seltenen Vögeln an jedem Orte, wo man sie antrifft, nachzustellen.
Und was vom Eisvogel gilt, das gilt in noch erhöhtem Maße von der Wasseramsel. Zwar entbehrt dieser[87] Vogel der tropischen Farbenpracht, aber er ist trotzdem eine der anmutigsten, lieblichsten Erscheinungen an unsern Gebirgsbächen, und ein hübsches Kleid besitzt er auch. Das weiße Vorhemd, das sich wirkungsvoll von der rostbraunen Unterbrust abhebt, steht ihm ganz allerliebst. In den Bewegungen, besonders dem fortwährenden Zucken des kurzen Schwänzchens, hat die Wasseramsel etwas vom Zaunkönig, mit dem sie auch verwandt ist. Sie gehört zu den Singvögeln und besitzt einen zwitschernden, grasmückenartigen Gesang. Dem Rieseln des Wassers, das auf steinigem Grunde dahinfließt, ist das plaudernde Lied zu vergleichen. Und wer je das Glück gehabt hat, die Wasseramsel beim Schwimmen und Tauchen zu beobachten, der wird immer mit Vergnügen an sie denken.
Mit dem feuchten Element ist die Wasseramsel von frühester Jugend an vertraut. Ihre Kinderwiege stand in einem Felsenloch am Ufer des Gebirgsbachs oder in einem ausgehöhlten Pfahl am Wehr, hinter dem sich das Wasser staut, vielleicht auch in dem Schaufelrad der alten verfallenen Mühle, die längst das Klappern verlernt hat. Hier verträumte das Vögelchen die ersten Tage seiner Kindheit. Es hörte das Rauschen des Bächleins; es sah, wie der Sonnenstrahl in dem rieselnden Naß unruhig glitzerte, wie die Mutter mit tropfenden Flügeln aus dem Wässerlein auftauchte, allerlei Leckerbissen im Schnabel, den Kindern zur willkommenen Speise. Und dem Bächlein bleibt der Vogel nun auch sein lebenlang treu. Gewissenhaft folgt er, talab oder talauf fliegend, all seinen Krümmungen; es ist, als müsse die Wasseramsel das rieselnde Wasser stets unter sich haben, auf das immer ihr schöner, großer Augenstern[88] gerichtet ist. Und Furcht vor dem Wasser kennt unser Vögelchen nicht. Auf einem Stein sitzt es, mitten im Strudel; dann läuft es hinein in den schäumenden Gischt. Bis zur weißen Hemdbrust schon reicht ihm das Wasser, jetzt bis zu den Augen, und jetzt ist das ganze Persönchen in dem klaren Waldbach verschwunden. Mit Flügeln und Füßen arbeitet der Vogel kräftig gegen die Strömung; dann taucht er wieder empor und surrt, die Tropfen vom Gefieder abschüttelnd, nach einem Ästchen, das niedrig über dem Bächlein herabhängt. Aber nur kurz ist die Ruhe. Dicht über dem Wasser fliegt das Vöglein weiter talaufwärts, wo es von einem andern Stein aus das Spiel von neuem beginnt. Selbst den kleinen Wasserfall fürchtet es nicht; im Flug durchschneidet es ihn und sucht hinter der herabstürzenden Flut nach Nahrung, die ihm der Bach allezeit spendet. Auch im härtesten Winter bleiben einige Stellen des lustig von Stufe zu Stufe hüpfenden Wässerchens eisfrei, daß der niedliche Vogel auch dann keine Not leidet. Ja mitunter läßt er schon mitten im Winter, wenn die Bäume ringsum unter der Schneelast sich neigen und über vereistem Grund das Bächlein talab hüpft, sein kleines Lied hören, und der kleinste der Kleinen, Zaunkönigs Majestät, gibt ihm Antwort: »Winter, wir fürchten dich nicht!«
Die Nahrung der Wasseramsel besteht aus allerlei Kleingetier, wie es jedes klare fließende Wasser am Grunde zwischen und unter den Steinen reichlich bietet: Larven und Puppen der Wasserkäfer, der Ufer- und Eintagsfliegen, Wassermotten, Wasserwanzen, Flohkrebschen, wohl auch eine Wasserschnecke, gelegentlich eine Elritze oder ein Stichling. An Forellenteichen wird es natürlich[89] auch vorkommen, daß sich die Wasseramsel an Forellenbrut vergreift. Aber der Schaden, den der hauptsächlich auf Insektenkost angewiesene Vogel der Fischerei zufügt, ist so geringfügig, daß wirklich kein Grund vorliegt, ihn zu verfolgen, wie es noch manchmal geschieht, obgleich das Gesetz ihn unter seinen Schutz nimmt.
Die Talgründe unserer Heimat, z. B. die anmutigen Seitentäler der Elbe, namentlich aber auch droben im Gebirge, wo nur immer ein klarer Bach zu Tal rinnt, beherbergen noch immer den reizvollen Vogel. Möge er uns erhalten bleiben, damit wir uns auch in Zukunft an dem anmutigen Leben und Treiben des Vögleins erfreuen können! Gleich dem Eisvogel gereicht es jedem Gebirgsbach zum lieblichsten Schmuck.
Einer der seltensten Brutvögel im Deutschen Reiche ist der Schwarzstorch. Bis auf einige Paare ist er aus unserm Vaterlande verschwunden. Unsre engere Heimat kennt ihn überhaupt nicht, höchstens daß er ausnahmsweise einmal an einem unsrer Gewässer auf seiner Herbst- oder Frühjahrsreise Rast macht. Ich habe den schönen Vogel wiederholt in Bosnien und in der Herzegowina angetroffen, während ich in Deutschland seinen Horst nur im Hannöverschen und am Darß (i. J. 1913) gesehen habe. In Ostpreußen soll es noch mehrere besetzte Horste geben, auch im Kreise Neu-Ruppin zählte man vor einigen Jahren noch drei Stück.
Wenn wir wünschen, daß dieses Naturdenkmal uns wenigstens in seinen spärlichen Resten erhalten bleibe, so werden uns sicher alle Verständigen zustimmen,[90] obwohl der Schwarzstorch ein großer Liebhaber von Fischen ist.
Unser gemütlicher Hausfreund, der weiße Storch treibt gelegentlich auch Fischfang. Sollen wir ihm deshalb böse sein? In Sachsen brütet der Storch fast nur noch in der Lausitz, wo sich aber heute nicht einmal ein Dutzend besetzter Horste befinden. Die Gemeinde, die ein Storchenpaar besitzt, ist stolz auf den gefiederten Kinderfreund, und mit Teilnahme beobachtet groß und klein alle Vorgänge, die sich am Horst abspielen. Wer den Vögeln ein Leid antut, setzt sich dem allgemeinen Unwillen der Bevölkerung aus. Trotzdem kommt es bisweilen noch immer vor, daß ein Storch abgeschossen wird; man findet einen solchen mitunter verendet im Teichgebiet. Wer ihn auf dem Gewissen hat, weiß man nicht. Man sollte aufhören, die wenigen Störche, die unser Sachsen noch beherbergt, mit Pulver und Schrot zu verfolgen. Sind wir wirklich so arm geworden, daß unsre sächsischen Gewässer nicht einmal mehr ein paar Dutzend Störchen eine kleine Zubuße zu ihrer täglichen Nahrung spenden können? Aber auch in noch storchreichen Gegenden Mecklenburgs, Pommerns usw. hat die Anzahl der Störche in erschreckender Weise abgenommen. Es ist höchste Zeit, daß wir alle unsre schützende Hand über diesen Vogel halten, der, wie die Schwalben, zu den volkstümlichsten Erscheinungen der gefiederten Welt gehört, lieb und wert schon unsern Voreltern in längst vergangenen Tagen.
Auch für den Fischadler, der besonders das norddeutsche Seengebiet bewohnt, habe ich schon manches gute Wort eingelegt und freundliches Gehör gefunden. Für unser Sachsen ist der stolze Fischer als Brutvogel schon[91] längst verschwunden; aber auf dem Zuge weilt er gern ein paar Tage an unsern stehenden Gewässern. Hoch über dem See zieht er dann seine Kreise; in Spiralen schraubt er sich tiefer. Plötzlich steht er, wie ein Falke rüttelnd, im Luftraum. Da stürzt er mit angezogenen Schwingen hinab. Das Wasser schlägt über ihm zusammen; aber im Nu taucht er wieder empor, einen Fisch in den Fängen. Ist es wirklich nötig, daß man diesen herrlichen Vogel sofort, wenn er sich zeigt, mit Pulver und Schrot empfängt? Ein paar Fische mag sein Besuch dem Teichpächter kosten; aber wie bald ist der edle Vogel wieder verschwunden!
Neben den bisher angeführten nur einzeln auftretenden Fischräubern gibt es aber auch Fischerei-Schädlinge, die kolonienweise brüten. Ihre Anzahl auf ein gewisses Maß zu beschränken, sie »kurz zu halten«, wie der Jäger sagt, das ist das unveräußerliche Recht aller, die ein unmittelbares Interesse an dem Blühen und Gedeihen der Fischerei haben. Freilich sind dabei große Unterschiede zu machen, und ein Kampf bis zur Vernichtung ist unter allen Umständen verwerflich.
Die Möwen, die nur ganz geringen Schaden anrichten, da sie zu wenig Taucher sind, um sich im tiefen Wasser der schnellen Flossenträger bemächtigen zu können und nur an ganz seichten Stellen oder dort, wo kleine Fische in Pfützen geraten sind, dem Fischfang obliegen, sollte man als herrliche Zierde unsrer Gewässer ruhig gewähren lassen. Bei uns im Binnenland handelt es[92] sich lediglich um die Lachmöwe, an der schokoladebraunen Gesichtsmaske kenntlich, die sie im Sommer trägt. Manche Kolonie an unsern Teichen ist eingegangen, fast alle sind schwächer geworden; der Rückgang seit zehn oder zwanzig Jahren ist ganz auffallend. Er hängt wohl weniger damit zusammen, daß übereifrige Fischer die Vögel beim Brutgeschäft stören, um sie zu vertreiben, als mit dem Eierraub, der oft in rücksichtslosester Weise Jahr für Jahr ausgeübt wird, bis die Vögel den unwirtlichen Ort verlassen und der Besitzer der Kolonie das Nachsehen hat.
Der Nutzen, den die Möwen für den Landwirt haben, ist unbestreitbar. Hinter dem pflügenden Landmann flattern und schreiten sie einher, die Insekten auflesend, die die Pflugschar freigelegt hat; ja, man kann beobachten, wie sie selbst der Mäusejagd auf den Feldern obliegen. Ihre Jungen füttern sie ausschließlich mit Kerbtieren, unter denen sich viele Fischereischädlinge befinden; ich habe niemals Fischreste an ihren Brutplätzen entdeckt. Auch an der Wasserkante macht sich der Rückgang aller Möwenarten von Jahr zu Jahr immer mehr bemerkbar. Früher sah man besonders bei stürmischer Witterung in den deutschen Seestädten viele Tausende von Möwen an und über den Hafengewässern, heute nur eine geringe Zahl. Jedenfalls hat der Fischer keinen stichhaltigen Grund, die Möwen zu verfolgen, und wenn Badegäste am Strand und vom Boot aus die anmutigen Segler der Lüfte, lediglich aus Übermut und um der Schießlust zu frönen, wegknallen, so sollte die dortige Bevölkerung den Frevlern solch verächtliches Handwerk gründlich legen. Den Schießern als Ziel zu dienen, dazu sind die[93] Möwen, die so recht ein Gottesgeschenk für unsre Küstengewässer wie Binnenseen bedeuten, wahrhaftig nicht da.
Auf und an fast allen größeren Teichen brüten, meist in mehreren Paaren, unsre vier Taucher, von denen der stattliche schöne Haubentaucher der seltenste ist. Er beansprucht eine größere Wasserfläche als die andern und kommt deshalb, namentlich auf den kleineren Gewässern unsrer Heimat, gewöhnlich nur vereinzelt oder in wenigen Paaren vor. Der Fischer ist sehr schlecht auf ihn zu sprechen; er betrachtet ihn als einen argen Räuber. Leider kann man diese Anklage nicht widerlegen. Selbst der Hinweis darauf, daß der Vogel doch auch viele Insekten vertilge, wird den Fischereiberechtigten kaum milder stimmen. »Insekten?« so entgegnet er uns, »die hätten ja auch den Fischen zur Nahrung dienen können; die Taucher verkürzen also auch noch jenen das tägliche Brot und schädigen mich so auf doppelte Weise.« Es ist schwer, dagegen etwas zu sagen, wenn man nicht immer wieder an die vielen räuberischen Insektenlarven erinnern will. Das Eine aber steht fest: bei solch einseitiger Betonung ganz bestimmter Interessen dürfte es bald aus sein mit dem Reichtum und der Mannigfaltigkeit der Natur. Mit demselben Recht würde der Brieftaubenzüchter fordern, daß er alle Raubvögel, der Imker, daß er Meisen und Fliegenschnäpper, der Obstzüchter, daß er Stare und Pirole abschießen dürfe. Wohin sollte das führen? Die kleineren Taucher, die Rot- und die Schwarzhälse, namentlich aber der winzige Zwergtaucher, tun der Fischerei wenig Abbruch; man sollte sie ruhig gewähren lassen. Den großen Haubentaucher aber sollte man gleichfalls schonen, weil er selten ist, nur vereinzelt vorkommt und dem Gewässer[94] zur schönsten Zierde gereicht. Freilich von Brut- und Streckteichen muß er ferngehalten werden.
Viel schlimmere Fischräuber sind die Kormorane. Aber für die deutsche Fischerei kommen diese Vögel nicht mehr in Betracht, da sie auf deutschem Gebiet sehr stark gezehntet worden sind. Sie waren bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts für ganz Norddeutschland ziemlich selten. Um 1810 legten sie aber auf Fünen eine große Kolonie an; hier wurden sie von den Fischern vertrieben. Ein Teil ließ sich auf Rügen nieder, wo die Vögel das gleiche Schicksal ereilte. Dann wanderten sie südwärts nach der Odermündung, und da man ihnen auch hier keine Ruhe gönnte, zogen sie weiter die Oder hinan bis in die Spreegegend. Pulver und Blei haben ihnen hier ein Ende bereitet. Es gab noch vor 50 Jahren an den verschiedensten Örtlichkeiten Deutschlands kleinere Kolonien dieser gefräßigen Fischer, z. B. an der Müritz, am Pinnower See bei Schwerin, am Mecklenburger Strand, an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins, im Oderbruch oberhalb Stettins, auf der Danziger Nehrung, am Frischen und am Kurischen Haff, am Mauersee in Masuren u. a. O. Heute ist das alles vorbei, und wenn wir von ein paar vereinzelten und unsicheren Brutstätten dieser Ruderfüßler absehen, so ist die Kormorankolonie im Kreise Schlochau in Westpreußen die letzte des Landes. Obgleich die Kormorane großen Schaden anrichten, so werden sie hier doch nicht vertilgt, »weil der Besitzer an den schönen interessanten Vögeln seine Freude hat«. (Vgl. Naumann, »Die Vögel Mitteleuropas«.)
Viel allgemeiner und auch viel gerechtfertigter sind die Klagen der Fischer über die Schädigungen durch den Fischreiher, gehört doch dieser stattliche Vogel auch heute noch vielen deutschen Ländern als Brutvogel an. Freilich auch seine Zahl ist, wie die aller größeren Vögel, außerordentlich zurückgegangen, und die wirklich reichbesetzten Reiherkolonien oder Reiherstände, welche Hunderte von Horsten vereinigen, gehören bereits zu den Seltenheiten. Viele Reiherstände sind völlig verschwunden. Nichts erinnert mehr daran, daß einst in den hohen Buchen und Eichen zahlreiche Horste standen; andere wieder, erst vor kurzem erloschen, zeigen noch in den Wipfeln der Bäume die verlassenen Brutstätten, bis schließlich ein Wintersturm die ineinander geflochtenen Reiser zerstreut. Jedenfalls sind die Zeiten vorbei, wo man sicher sein konnte, im Frühling und Sommer an jedem Fluß, an jedem See wenigstens einige dieser schönen Vögel anzutreffen.
Im Mittelalter und auch später noch, bis ins 17. Jahrhundert, erfreuten sich edle Herren und Damen an der Reiherbeize. In frohem Zuge ritt man von der Burg herab, gefolgt von Jagdgästen, Falkonieren und der bellenden Meute. Zeigte sich ein Reiher, so ließ der Jagdherr und gleich darauf eine der Damen die schnell entkappten Falken steigen, die nun versuchten, das immer höher gehende Beutetier gemeinsam unter sich zu bringen. »Wie auf der Fuchshatz sausen Reiter und Reiterinnen durch dick und dünn, den sich in der Ferne fast verlierenden Kämpfern nach. Endlich hat ein Falk die Fänge in die dicken Schwingen des Reihers gehakt, und beide Partner wirbeln zur Erde. Der erste Reiter packt sie, bekappt den Falken und stellt den Reiher der Dame vor.«[96] Die unbeschädigten Reiher, denen man nur ein paar Schmuckfedern nahm, ließ man dann oft wieder fliegen; doch tötete man sie auch bisweilen, weil ihr Wildbret auf vornehmen Tafeln sehr geschätzt war.
Der Reiher gehörte damals zur »hohen Jagd«, deren Ausübung das Vorrecht hochstehender Personen, geistlicher und weltlicher Würdenträger, war. Die Strafen, mit denen die unbefugte Tötung eines Reihers bedroht ward, waren äußerst hart. Kein Reiherhorst durfte zerstört, kein Ei genommen werden, und nur dem Fischereiberechtigten war es allergnädigst gestattet – Scheuchen aufzustellen. In Sachsen erreichte die Falknerei unter August dem Starken ihren Höhepunkt; es wurden stattliche Summen für diesen Jagdsport ausgegeben, und wenn die Falken auch auf das verschiedenste Federwild, z. B. Trappen, Gänse, Schwäne, Rebhühner, Wachteln, losgelassen wurden, die Beizjagd des Reihers blieb doch immer die Hauptsache.
Wie haben sich die Zeiten gewandelt! Das deutsche Vogelschutzgesetz hat die Reiher, sowohl den grauen Fischreiher, wie den Nachtreiher und die Rohrdommel, auf die Liste der Geächteten gesetzt; es gewährt ihnen in keiner Weise irgendwelchen Schutz, und die preußische Jagdordnung vom 15. Juli 1907, die doch alle Sumpf- und Wasservögel als jagdbare Tiere bezeichnet, schließt die grauen Reiher – ebenso die Taucher, Säger, Kormorane und Bläßhühner – von diesem Vorrecht aus. In Preußen entbehren also die Fischreiher des Jagdschutzes, während die andern Reiherarten, eingeschlossen die Rohrdommeln, jagdbar sind. Der Fischreiher unterliegt somit in Preußen dem freien Tierfang, d. h. er darf auch vom Nichtjagdberechtigten allezeit gefangen, getötet[97] und seiner Brut beraubt werden; er ist völlig schutzlos, der Willkür eines jeden preisgegeben.
Bei uns in Sachsen liegen die Verhältnisse insofern etwas anders, als die Reiher jagdbar sind. Es hat also nur der Jagdberechtigte ein Anrecht auf sie. Irgendwelche Schon- und Hegezeit ist den Reihern freilich versagt. Das Gesetz über die Ausübung der Fischerei vom 15. Oktober 1868 gestattet aber auch den Fischereiberechtigten, den Fischreiher – ebenso den Fischotter – zu fangen und ohne Benutzung des Schießgewehrs zu töten. Innerhalb 24 Stunden sind die auf diese Weise erbeuteten Vögel an den Jagdberechtigten auszuliefern. Auf die andern Reiherarten steht dem Fischer kein Anrecht zu. Ähnlich lauten die Bestimmungen in den meisten deutschen Einzelländern. In Bayern, Sachsen-Weimar, Hessen ist der Fischreiher wie bei uns jagdbar, in Württemberg, Baden, Mecklenburg, Oldenburg vogelfrei wie in Preußen.
Ich wüßte keinen einheimischen Vogel zu nennen, dessen Geschlecht in den letzten 150 bis 200 Jahren so blutigen Verfolgungen ausgesetzt gewesen wäre, wie der Fischreiher, und wenn diese Verfolgungen heute auf ein geringeres Maß zurückgegangen sind, so liegt der Grund hierfür nur in der Tatsache, daß die Reiher an Zahl außerordentlich stark abgenommen haben. Der Haß, mit dem man dem Fischräuber begegnet, ist der gleiche geblieben. Wo sich der schöne, schon durch seine Größe auffallende Vogel zeigt, und sei es auch nur auf der Wanderung, wenn er ein wenig rastet, da sucht man seiner habhaft zu werden; an den Horstplätzen aber wird zur Brutzeit unter den Alten sowohl, wie namentlich unter den bald flugbaren Jungen, die auf dem Horstrand hocken,[98] oftmals das furchtbarste Blutbad angerichtet. Am Wasser stellt der Fischer versteckte Fangeisen auf; tollkühne Burschen klettern an den hohen Horstbäumen empor und wagen sich bis zu den Nestern, die häufig auf den schwankenden Enden der Äste ihren Platz haben; sie rauben die licht-grünlichblauen Eier, deren das volle Gelege meist 4 bis 5 Stück zählt. Prämien, von Fischereivereinen gewährt, locken immer mehr zu rücksichtsloser Vertilgung. In der Tat, man muß sich wundern, daß es auch heute noch im Deutschen Reiche eine Anzahl von Reiherhalden gibt – gegen früher allerdings nur spärliche Reste. Ich fürchte sehr, daß auch diese in einem halben Jahrhundert fast völlig verschwunden sein werden, und daß dann der Reiher für Deutschland als Brutvogel ebenso selten sein wird, wie heute schwarzer Storch, Kolkrabe, Uhu oder Wanderfalk.
In Süddeutschland, d. h. südlich des Mains, gibt es schon jetzt kaum noch ein paar kleinere Kolonien; sie sind fast alle in den letzten 30 oder 50 Jahren vernichtet oder versprengt worden, so daß sich nur noch hie und da einzelne Reiherhorste finden. Als fast einzige Ausnahme ist die Kolonie bei Schloß Morstein an der Jagst, auf der Besitzung des Freiherrn von Crailsheim, hervorzuheben; aber auch sie ist stark zurückgegangen, und von den 200 Horsten, die sie vor einigen Jahren zählte, wird wohl kaum noch die Hälfte besetzt sein, obgleich die Besitzer von jeher den schönen Tieren Schutz gewährten und auf manche Vorteile verzichteten. Es ist leicht möglich, daß diese Kolonie das ehrwürdige Alter von mehr als einem halben Jahrtausend erreicht hat; denn eine Nachricht aus dem Jahre 1586 besagt, daß die Reiher hier schon »seit vielen hundert Jahren« horsten. Die Maingegend zählt[99] noch einige Reiherstände; in Mittelfranken beherbergte z. B. der Windheimer Stadtwald Schoßbach im Forstamte Ipsheim noch vor einiger Zeit eine Kolonie von 20 bis 25 Horsten; wie es heute um sie steht, weiß ich nicht. Auch im Hessischen gibt es noch einige kleine Reiherhalden, während die Kolonien bei Nürnberg, Neuhaus in der Fränkischen Schweiz u. v. a. der Vergangenheit angehören. In ganz Elsaß-Lothringen scheint der Fischreiher nur als Strichvogel und auch nur ausnahmsweise vorzukommen, und in der Rheinprovinz ist sein Brutgebiet ganz beschränkt.
In den übrigen Ländern Mittel- und namentlich Norddeutschlands ist der Reiher noch häufiger; er fehlt als Brutvogel wohl keiner preußischen Provinz völlig und tritt ebenso in Oldenburg und in Mecklenburg in mehreren Kolonien auf. Aber es gibt doch auch weite Gebiete, wo man heute vergeblich selbst nach nur einzelnen Reiherhorsten suchen würde. Unserm Sachsen fehlt der Reiher als Brutvogel völlig, nachdem die letzte Kolonie auf den alten Eichen einer Insel im »Horstsee« bei Schloß Hubertusburg durch Fällen der Bäume i. J. 1888 vernichtet worden ist. Einige Reiher zogen sich wohl nach dem Wermsdorfer Wald zurück, sind aber auch dort schon längst völlig verschwunden.
Die letzte Kolonie ganz in der Nähe der sächsischen Grenze, nur 10 oder 11 km von ihr entfernt, nördlich von Königswartha, die ich i. J. 1912 besuchte, stand in einem öden Kiefernwald bei Weißkollm. Ich konnte im ganzen 16 Horste zählen, die bis auf einen sämtlich besetzt waren: mächtige Bauwerke aus starken Reisern, 1½ bis gegen 2 m im Durchmesser, mit weißem Kot übertüncht. Generationen haben an diesen Horsten gebaut, die seit[100] Menschengedenken von den schönen Vögeln bewohnt wurden. In jedem Jahr die gleiche Anzahl von Reiherfamilien, nicht mehr und nicht weniger. Ein herrlicher Anblick, wenn die stolzen Segler der Lüfte ruhigen Flugs über den uralten Föhren, die ihre Nester tragen, in schwindelnder Höhe kreisen! Kopf und Hals sind auf den Rücken gelegt, daß nur der lange Schnabel hervorschaut; die Ständer werden weit nach hinten gestreckt, und in dem schönen Federbusch am Kropf spielt lustig der Wind. Dann läßt sich ein oder der andere Reiher auf dem Horstrand nieder und füttert die Jungen mit Fischen, die er ihnen aus weiter Ferne im Kehlsack bringt; denn ein Gewässer findet sich nicht in der Nähe. Wie ich mit großem Bedauern höre, ist in den letzten Jahren die Kolonie stark zurückgegangen, vielleicht ganz verschwunden.
Hannover, Schleswig-Holstein, Pommern, West- und Ostpreußen beherbergen noch immer eine stattliche Anzahl von Reiherhorsten; Posen, Schlesien, Brandenburg, die Provinz Sachsen sind schon ärmer daran. Man sieht, der Reiher bevorzugt im allgemeinen die Niederungen mit ihren ruhig fließenden oder stehenden Gewässern, dazu die Meeresküste. Ob das Jagdgebiet mehr oder weniger im freien Gelände liegt, ob dichtes Gebüsch die Ufer besetzt oder ob finsterer Wald den See von allen Seiten umgibt, das ist den Reihern gleich, sobald sich nur seichte Uferstellen finden, wo sie, im flachen Wasser stehend, dem Fischfang ungestört obliegen können.
Die größte Reiherkolonie habe ich vor ein paar Jahren – es war in der zweiten Hälfte des Mai – an der deutschen Ostseeküste besucht. Den Ort verschweige ich; ebenso verrate ich nicht, wieviel besetzte Horste hier auf[101] den hohen Eichen stehen mögen. Sonst fangen die pommerschen Boddenfischer, wenn sie's hören, sofort an zu multiplizieren, erst die Anzahl der Reiherpaare mal zwei bis drei Dutzend spannenlanger Fische, das Produkt mal 180 – so viele Tage ungefähr weilt der Reiher an seinem Brutplatz – dann wird dividiert, nun weiß man die Kilo, und wieder multipliziert – man hört ganz deutlich die Goldstücke klimpern, die man ohne die Reiher einheimsen könnte. Aber von dem Schaden, den die Fischer sich selbst dadurch zufügen, daß auch sie so oft alles kleine Fischgewürm, das sich in den Netzen gefangen hat, mit zu Gelde machen, davon wollen die Leute nichts hören.
Wenigstens 20 bis 25 m schätzte ich die Höhe der Horste. Manche Eiche trug deren fünf oder sechs. Die Alten fütterten eifrigst, viele brüteten aber auch noch. Die großen Vögel kreisten schreiend über den Horstbäumen. Ihre riesigen Schatten huschten ganz eigentümlich zwischen den Eichen, deren Kronen noch ziemlich unbelaubt waren, dahin. Es sah noch leidlich reinlich im Nistrevier aus: ein paar Eierschalen, etwas weißer Kot und nur ausnahmsweise ein verwesender Fisch. Wie anders, wenn man später kommt! Da muß man in solchem Unrat förmlich waten, wie es mir erging, als ich vor vielen Jahren einmal im Sommer eine große Reiherkolonie an der Elbe, unterhalb Wittenberg, besuchte.
An einem der folgenden Tage sollten einige Reiher abgeschossen werden. Auf höheren Befehl mußte sich der Oberforstmeister dazu bequemen; denn die Fischer hatten sich schon ein paarmal bei der Regierung beklagt, daß man hier die Reiher, die doch so grenzenlosen Schaden[102] anrichten, ruhig gewähren lasse, ja sie geradezu hege und züchte. »Zwölf Stück, nicht mehr!« so lautete die strenge Weisung, die der Oberforstmeister uns gab, »und nicht zwei von demselben Horstbaum abschießen, damit der Überlebende des Paares die Brut weiter aufzieht, auch peinlich darauf achten, daß kein Reiher dabei in den Horst fällt, wodurch die Jungen elend umkommen müssen, also nicht schießen, wenn der Reiher gerade über seinem Nest schwebt!« Wir hatten das Dutzend schnell zusammen; denn wenn auch nach jedem Schuß die Vögel abstreichen, sie kommen doch recht bald wieder, falls man sich nur ein wenig hinter den Stämmen versteckt. Die Mutterliebe läßt sie die Gefahr nicht achten.
Die armen zwölf Stück! Für die andern hatten sie das Leben gelassen – Opfer des Vogelschutzes, so seltsam es klingt. Ein mäßiger Abschuß war eben unbedingt nötig, um den Klagen der Fischer etwas gerecht zu werden. Nur auf diese Weise läßt sich die Brutkolonie dauernd erhalten. Wir banden die prächtigen Tiere, damit sie von allen Dorfbewohnern gesehen würden, an den Jagdwagen und fuhren durch ein paar Dörfer mehr, als nötig gewesen wäre, wieder heimwärts. Schaut, ihr Fischer, wie man sorgt, daß ihr die Fischräuber los werdet, und haltet den Mund nun!
An unsern sächsischen Teichen, ja sogar an Gebirgsbächen halten sich die Reiher, namentlich auf ihrer Wanderung, gern auf; es findet sich überall ein Plätzchen, wo selbst das schnellfließende Wasser seinen eiligen Lauf unterbricht. Den Hals niedergebogen, den Schnabel gesenkt, den spähenden Blick auf den Wasserspiegel gerichtet, so schleichen die schlanken Gestalten mit behutsamem Tritt am Ufer entlang; sie gehen nur so weit ins[103] Wasser, daß es ihnen höchstens an die Fersen reicht. Bisweilen verharren sie auch stundenlang unbeweglich fast auf demselben Fleck. Nur von Zeit zu Zeit schnellt blitzartig der Hals vor, so daß der Schnabel, oft auch zugleich der Kopf unter der Wasserfläche verschwindet. Selten nur geht der Stoß fehl; das Bajonett trifft sein Ziel mit großer Sicherheit. Der zappelnde Fisch wandert sofort in den unersättlichen Schlund.
Außer Fischen fängt der Reiher auch Frösche, Kaulquappen, größere Wasserkäfer, Libellen und ihre Larven, Regenwürmer; selbst den Mäusen stellt er nach, ebenso jungen Sumpf- und Wasservögeln, und manchmal muß er seinen Hunger mit dünnschaligen Teichmuscheln stillen. Aber Fische, von den kleinsten angefangen bis zur Größe von etwa 20 cm, daß er sie gerade noch hinabzuwürgen vermag, sind ihm doch die liebste Kost. Nach der Art der Flossenträger fragt der Reiher dabei nicht im geringsten. Kleine Karpfen, Hechte, Forellen, Karauschen, die verschiedenen Weißfischarten, Aale, Schleien, selbst Barsche und Stichlinge – es ist ihm alles willkommen, mehr auf die Menge sieht er als auf die Güte.
Unter solchen Umständen kann man es dem Fischereiberechtigten nicht verdenken, wenn er auf den hochbeinigen Mitbewerber sehr schlecht zu sprechen ist, und es wäre jeder Versuch, diesen weißwaschen und seine Diebereien beschönigen oder gar leugnen zu wollen, von vornherein lächerlich. An ganz fischarmen Gewässern richtet der Räuber natürlich keinen Schaden an, schon aus dem Grunde nicht, weil er sich dort nie lange aufhalten wird; ebenso meidet er alle Gewässer, die sofort am Ufer so tief einsetzen, daß er darin nicht waten kann. Auch wo regerer Menschenverkehr Unruhe bringt, zeigen[104] sich nur ausnahmsweise einmal ein paar Reiher. Der Vogel findet es sehr schnell heraus, wo eine reiche Beute seiner wartet, und sein regelmäßiges Vorkommen in einer bestimmten Gegend ist – ich möchte sagen, der erfreuliche Beweis dafür, daß die Gewässer der Umgebung sehr fischreich sind.
Naturfreunde haben zur Ehrenrettung des Reihers darauf hingewiesen, daß dort, wo »wilde Fischerei« betrieben wird, wie vielfach in den Gräben der Elb- und Wesermarsch, der Fischer dem Vogel nichts vorzuwerfen habe: Raubfischerei üben sie beide, indem sie ernten, wo sie nicht säten. Ist aber die Konkurrenz deswegen weniger ärgerlich? Zur Brutzeit, so hat man weiter gesagt, fange der Reiher nur kleine Fische, »Seitenschwimmer«, wie sie sich massenhaft in der Nähe der Ufer herumtummeln. Indessen, die Horstjungen entwickeln sich schnell und bedürfen sehr bald größerer Bissen, und außerdem aus der Unmenge kleiner Fischlein würden doch im Laufe der Zeit wenigstens einige große wertvolle Fische heranwachsen. Viele Flüsse und namentlich die Boddengewässer am Meer, hat man gemeint, seien so reich an Fischen, daß der Abbruch, den die Reiher zufügen, nicht der Rede wert wäre. Wer so urteilt, der hat sich's sicher noch nicht klar gemacht, daß eine größere Reiherkolonie von hundert Horsten und mehr gewiß auch gegen hundert Zentner alljährlich an Nahrung bedarf. Freilich gefangen werden müßte diese Menge auch erst von den Fischern, eine Arbeit, die ihnen die Reiher abnehmen.
Nur das eine wird man bis zu gewissem Grade gelten lassen: es fallen mehr die Raubfische im weitesten Sinne, wie Aale, die dem Fischlaich nachstellen, Hechte und[105] Barsche, die den Jungfischen verderblich werden, und minderwertige Weißfische den Reihern zur Beute, weil sich die genannten mehr an jenen Örtlichkeiten aufhalten, wo die Vögel mit Erfolg zu fischen vermögen, während andere, z. B. Karpfen und Schleien, die Tiefen vorziehen und die Nähe der Ufer gewöhnlich meiden. Auch die Forelle, die sich mit Vorliebe an steilen Ufern aufhält und unter Steinen und Wurzeln gern Deckung sucht oder in starker Strömung auf dem Anstand steht, ist dadurch vor den Reihern einigermaßen gesichert. Wo aber künstliche Fischzucht getrieben wird, wo ein nach vielen Tausenden zählendes Kapital sich verzinsen muß, da kann man den regelmäßigen Besuch der Reiher unter keinen Umständen dulden.
Wie bei so vielen Fragen, muß auch hier immer von Fall zu Fall entschieden werden. Es gibt sicher unzählige Gewässer im Deutschen Reich, wo man nicht sofort jeden Fischreiher zu fangen oder niederzuknallen braucht, wenn sich mal einer zeigt, und ich kenne manchen Fischereiberechtigten, der gern eine kleine Einbuße erleidet, weil auch er an dem herrlichen Vogel, der die Landschaft belebt, seine Freude hat. Es gibt aber auch genug Besitzer oder Pächter, die selbst mit geringen Summen rechnen müssen. Könnte hier nicht – natürlich nur von Fall zu Fall – der Staat eintreten und den Schaden ersetzen, oder sollten sich bei der großen Naturschutzbewegung unsrer Tage nicht einige begeisterte Vogelfreunde finden, die bereit wären, ein Scherflein zu opfern, um ein paar Reiher, vielleicht die einzigen in einer weiten Landschaft, zu retten? Unwirtschaftlich, so wird man diesen Vorschlag nennen. Mag sein – aber[106] ich frage: Läßt sich der Nutzen und Schaden eines Tieres immer nur berechnen nach Geld und Geldeswert?
Soviel steht fest: durch die maßlose Verfolgung ist der schöne Vogel für viele Gegenden unseres Vaterlandes dem Aussterben nahegebracht. Mag man ihn dort, wo er noch in größerer Zahl auftritt und empfindlichen Schaden anrichtet, auch weiter kurz halten, ein paar Reiherhorste sollte man doch zu erhalten suchen, auch ein paar größere Kolonien unter staatlichen Schutz stellen.
Zu der Familie der Reiher gehört auch die große Rohrdommel. Sie ist selbst in unserer sächsischen Lausitz, wo ich ihrem unheimlichen nächtlichen Liebeslied oft und oft gelauscht habe, recht selten geworden. Zum Glück führt sie ein verstecktes Leben, sonst wäre wohl auch der letzte dieser interessanten Vögel schon längst verschwunden; denn der Fischer ist auch auf die große Rohrdommel schlecht zu sprechen. Gewiß, ihre Hauptnahrung mag in Fischen und Fischbrut bestehen, wenn sie daneben auch viele schädliche Insekten frißt; aber sie ist im Gegensatz zum Fischreiher ein ungesellig lebender Vogel, der schon aus diesem Grunde nicht allzuviel Schaden anrichten wird. Dazu kommt, daß die eigentlichen Brutteiche von der Rohrdommel gemieden werden, weil dort gewöhnlich nicht so viel Rohr und Schilf wächst, daß sich der scheue Vogel gut verstecken kann. Wo die große Rohrdommel so selten ist, wie in unserer Lausitz, da sollte man sie schonen und ihr den kleinen Tribut an Fischen gönnen. Namentlich möchte ich alle Jäger[107] bitten, den seltenen Vogel, wenn er gelegentlich der Entenjagd sein Versteck verläßt, nicht abzuschießen. Es wäre doch schön, wenn er unsrer Heimat erhalten werden könnte! Die seltene kleine Rohrdommel, ein allerliebstes Zwergreiherchen, das behend im Rohrwald auf- und abklettert, wird noch viel weniger schädlich sein; solch kleiner Magen bedarf nicht viel. Die andern Reiher aber, Nacht- und Purpurreiher, sind so seltene Gäste unsrer Gewässer, daß es die Pflicht jedes Jagdberechtigten sein muß, das Gastrecht diesen Fremdlingen gegenüber zu wahren.
Außer den genannten mögen auch wilde Enten, Gänse und Schwäne, dazu an der Meeresküste der mächtige Seeadler manchen Schaden anrichten, besonders wenn man bedenkt, daß doch neben den Fischen selbst auch deren Laich für viele an und auf den Gewässern lebende Vögel einen Leckerbissen bildet. Schließlich ist vielleicht kein einziger Sumpf- und Wasservogel ganz freizusprechen. Wollte man sie alle ihre gelegentlichen Übergriffe büßen lassen, so wäre es bald vorbei mit dem reichen Leben, das die meisten Teiche und Seen noch immer beherbergen.
Nur einen Fischereischädling aus der Klasse der Kriechtiere wollen wir noch erwähnen, die Ringelnatter. Sie ist bekanntlich eine vorzügliche Schwimmerin. Ein wahres Vergnügen, ihr zuzusehen, wie der schlanke, geschmeidige Schlangenleib in auserlesen schönen Windungen an der Oberfläche des Wassers dahingleitet, den breiten Teich durchquerend oder die Strömung des Flusses überwindend. Selbst weit hinaus ins Meer schwimmt sie, habe ich doch einmal eine Ringelnatter im Barther Bodden, wohl 5 km weit vom Land, vom[108] Fischerboot aus beobachtet und gefangen; ein fingerlanges Fischchen erbrach sie vor Schreck. An und in unsern Fischteichen in der Lausitz gibt's Ringelnattern genug, und ich verstehe es, daß die Fischereiberechtigten ihnen recht feind sind, wenn es sich auch nur um kleine Flossenträger handelt, denen die Nattern nachstellen. Im übrigen aber sind diese Schlangen ganz unschuldige Geschöpfe, die man an jedem Gewässer, das nicht gerade der Fischwirtschaft dient, ruhig gewähren lassen sollte.
Wenn jeder, den es angeht, erkennen wollte, daß die allgemeinen Interessen höher stehen als die besonderen des einzelnen, dann würde uns die Sorge um den Fortbestand der sogenannten »Fischräuber« von der Seele genommen.
Fröhlichen Ringelreihen tanzen Buben und Mädel auf maigrünem Anger. »Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her«, singen die hellen Kinderstimmen dazu, und dann folgt ein anderes ausgelassenes Spiel mit tüchtigem Rennen und Jagen; »der Fuchs kommt«, nennen sie's, jeder spielt es so gern.
Ja, in aller Munde ist er und allen vertraut, Freund Reineke mit der buschigen Lunte und dem ergötzlichsten Schelmengesichtchen der Welt; selbst das kleine Nesthäkchen auf Mutters Schoße kennt das Konterfei des schlauen Betrügers im Bilderbuch ganz genau, und die älteren Geschwister wissen manche Geschichte von ihm: wie er dem eitlen Raben den Käse abschmeichelt, die unschuldigen Tauben berückt, den stolzen »Gockelmann« packt, wie er seinem größeren Vetter, dem Wolf, so arg mitspielt, den Hasen um seinen Schwanz bringt, wie er aber bisweilen auch selbst genarrt wird, von der Katze und vom Hahn, ja sogar vom harmlosen Häschen. Das Lesebuch enthält all diese schönen Geschichten, die Brüder Grimm, Ludwig Bechstein, Hagedorn, Simrock und besonders Robert Reinick – es liegt schon im Namen – den Kindern erzählt haben; sie werden nicht müde, die hübschen Märchen und Fabeln immer von neuem zu lesen. Und[110] dann das plattdeutsche Epos »Reinke de Vos«, das 1498 zu Lübeck gedruckt ward, und endlich der ganz große Dichter, hat er nicht auch dem Fuchs ein Denkmal gesetzt, seine lustigen Streiche für alle Zeiten verewigt!
Ein Denkmal – ach ja, das ist der richtige Ausdruck! Als Goethe sein Tierepos schrieb, da galt es noch einem Lebenden; heute ist der Fuchs aus manchem deutschen Gau verschwunden, und wenn man ihm weiter so rücksichtslos nachstellt mit Gift und Fangeisen und tödlichem Blei, wenn der Jäger im Frühling jeden Bau seines Reviers ausgräbt und die niedlichen Jungfüchse den mordlustigen Hunden erbarmungslos preisgibt, so wird es auch über kurz oder lang von Reineke heißen, wie vom Wolf, vom Luchs und von der Wildkatze: vergangen, vorbei! Wohl lebt er dann noch weiter im Bild, im Lied und im Märchen – »es war einmal …«, aber draußen in freier Natur auf sonniger Heide läuft dem Wanderer nie ein Fuchs mehr über den Weg, und Malepartus, die Raubburg, liegt tot und verlassen. Höchstens hoppeln Karnickel vor ihren Eingängen; die haben jetzt gute Zeit, wie die Mäuse im Haus, wenn die Katze vom bösen Nachbar in der Kastenfalle gefangen und dann grausam ersäuft ward. Vielleicht sehe ich zu schwarz. Der schlaue Betrüger hat es ja noch immer verstanden, dem Jäger ein Schnippchen zu schlagen, und in den größeren waldreichen Revieren, im Gebirge wie im Niederland, haust Reineke auch heute noch und fristet sein Leben, so gut er's vermag. Ja, während der Kriegszeit haben die Füchse, so sagte man mir, hier und da stark an Zahl zugenommen; die Männer vom grünen Tuch standen an der Front und hatten wichtigere Arbeit, als Jungfüchse zu graben oder den alten Rüden und Fähen nachzustellen.[111] Aber seit der Preis eines guten Winterbalgs eine schwindelnde Höhe erreicht hat, ist auch die Gefahr für den Roten, dem Jäger zum Opfer zu fallen, erheblich gestiegen.
's ist doch gar ein lieber Kerl trotz aller bösen Ränke und Schliche, und erst seine hoffnungsvollen Sprößlinge – ergötzlichere Kinder, allezeit lustig, übermütig, flink und täppisch zugleich, gibt es weit und breit in keiner andern Familie.
Ich weiß einen Fuchsbau, der liegt mitten drin in der einsamen Heide. Außer mir weiß nur noch der Förster davon, und der ist mein Freund. Er hat mir versprochen, in diesem Jahr die alte Fähe und ihre Jungen zu schonen, weil es der einzige Fuchsbau in dem ganzen Revier ist. Die Karnickel unterwühlen den lockeren Boden in entsetzlicher Weise und benagen die jungen Bäumchen der Schonung, daß man wirklich nur froh sein kann, wenn sie jemand in Schach hält.
Folgt mir hinaus an die Stelle! Jetzt im April ist's am lustigsten dort. Die Birken am Weg haben ihr duftiges Brautkleid angezogen, das sich so schön von den dunkeln Nadeln der ernsten Föhren abhebt; die Singdrossel jubelt im Wipfel des einsamen Überständers; der Specht ist an seiner Arbeit, und richtig – der erste Kuckuck! Wohl hundertmal ruft er; man freut sich doch in jedem jungen Lenz wie ein Kind, wenn man den lieben Ruf von neuem vernimmt.
An einem sanften Hang zwischen niedrigen Kiefern ist eine Lichtung. Dornige Sträucher, Heidekraut, allerhand Gräser und Stauden bedecken den Boden, auch ein Paar Bäumchen mit gelbbraunen vertrockneten Nadeln liegen, die Stämmchen gekreuzt, wirr umher; der Herbststurm[112] im vorigen Jahre entwurzelte sie, denn der unterhöhlte Boden gab ihnen keinen sicheren Halt. Ja, an zwei Stellen ist das lockere Erdreich in die Tiefe gesunken, unregelmäßige Löcher, etwa einen Meter im Durchmesser. Früher hauste der Dachs hier; jetzt sind es die Eingänge von Reinekes Wohnung, zu der enge »Röhren« hinabführen. Weiter oben ist noch ein ähnliches Loch, nicht ganz so groß, und etwas abseits ein viertes; das ist aber verschüttet.
Daß der Bau wirklich bewohnt ist, erkennt man sofort. Die Einfahrten sind glatt getreten, und aus dem Innern dringt uns ein unangenehmer Geruch entgegen, daß wir den Atem anhalten. Diesen Fuchsgeruch zu beschreiben, ist nicht möglich; wer aber das durchdringende Parfüm nur ein einziges Mal frisch an der Quelle eingesogen hat, der bringt's so leicht nicht wieder aus der Nase, und unverlierbar bewahrt er's in seinem Gedächtnis. Auch die Reste der Mahlzeiten, die hier und da vor dem Bau liegen, verpesten mit ihren Verwesungsdüften die Luft, und nur die vielen Schmeißfliegen, die sie umschwärmen, haben ihre Freude daran. Hier der Flügel einer Krähe, dort eine angefressene Ratte, daneben der Lauf eines Rehs, unter dem Kieferngestrüpp der Kopf eines Karnickels, verschieden große Fetzen vom Fell eines Hasen, mit Blut besudelte Federn der Ringeltaube und ganz nah an der einen Einfahrt sogar der bleiche Schädel einer Hirschkuh; irgendwo hat die Füchsin das verendete Tier aufgefunden und dann den abgebissenen Kopf mühsam hierhergeschleppt. Dies alles bildet ein Stilleben eigentümlicher Art; es redet eine deutliche Sprache von List und Gewalt, von Mordgier und – Mutterliebe!
Die Sonne neigt sich zur Rüste, die Wipfel der einzelnen hohen Föhren, die auf das Jungholz herabschauen, in purpurnes Licht tauchend. Da wird es lebendig vor dem Fuchsbau. Ein verschmitztes Gesichtchen erscheint in einem der Eingänge; es blinzelt nach links und nach rechts und hinauf zu dem tiefblauen Himmel. Dann mit einemmal ist der kleine Kerl draußen. Auf den Hinterbeinen hockend, richtet er sein Köpfchen altklug empor, als wollte er schauen, was für Wetter es heut abend gibt und wie für morgen die Aussichten sind. Das feine Näschen schnuppert dabei nach allen Richtungen, und das dichte Wollkleidchen an der Brust zittert; so heftig und schnell atmet die Lunge die Luft ein und aus. Das Füchslein sichert, es »wittert«, ob sich etwa eine Gefahr in der Nähe versteckt hält; von der Frau Mutter hat's der Kleine gelernt und macht es nun auch so wie sie – oder liegt ihm diese Vorsicht von Haus aus im Blut? Nun schüttelt das Füchslein sein licht gelblichgraues Kinderkleid, das beim langen Schlaf in dem engen Raum etwas verdrückt ward, fährt mit dem einen, dann mit dem andern schwärzlichen Pfötchen über die Lauscher und über's Gesicht; aber plötzlich mit einem Hops ist es wieder am Röhreneingang und äugt scharf in die Tiefe, ob die Geschwister nicht nachkommen. Alle Muskeln gespannt, ohne jede Bewegung; nur der horizontal ausgestreckte Wollschwanz schwingt ganz leise nach rechts und nach links.
Ein täppischer Satz zur Seite – da ist schon der erwartete Bruder. Er blinzelt gegen die untergehende Sonne, deren letzter Strahl sein grau-grünliches Auge trifft. Nun kann es beginnen, das fröhliche, ausgelassene Spiel. Mit den Perlenzähnchen haben sie einander gepackt, jetzt[114] im dichtwolligen Nacken, jetzt an den Pfoten, dann an der Lunte oder am Ohr. Sie zerren ganz tüchtig, balgen und kollern sich mutwillig am Boden umher, richten sich gegenseitig auf, mit den Vorderpfoten einander umarmend, überschlagen sich und kugeln den Hang ein Stückchen hinunter; doch mit raschen Sprüngen geht's wieder hinauf. In geduckter Haltung kauern sie jetzt einander gegenüber, jeder zu neuem Angriff bereit und einer vom andern erhoffend, daß er das hübsche Spiel wieder beginne. Da springt der eine Partner plötzlich empor: Brüderchen hasch' mich! Keuchend mit hängender Zunge geht es rings um den Bau, bis sie sich wieder gepackt haben.
Erst wenn die ausgelassenen Füchslein müde und ganz außer Atem sind, rasten sie ein wenig in hockender oder in liegender Stellung, »alle Viere« weit ausgestreckt. Aber während die Lunge noch keucht, daß Brust und Weichen sich heftig bewegen, sinnt das kluge Gesichtchen mit den listigen Augen und den aufrecht gestellten Lauschern schon wieder nach neuem, noch tollerem Spiel. Sie zerren am Krähenflügel, machen sich jeden Fetzen vom Hasenbalg streitig – was der eine packt, das will der andre gerade auch haben, »man weiß, wie Kinder sind« – dann suchen sie den schwirrenden Roßkäfer täppisch mit den dunkeln Pfoten zu erwischen oder schnappen nach dem Abendfalter, der ihnen um die Nase herumfliegt. Unterdessen sind auch die drei andern Geschwister auf der Bildfläche erschienen, und nun geht es noch lustiger zu. »Der Jäger kommt!« spielen sie gern. Das machen sie so: keins darf sich rühren, nicht mit den Ohren zucken, keinen Muskel bewegen. Plötzlich springt eins in die Höhe; einen Haken schlagend, rennt der kleine Kobold[115] davon, so schnell er nur kann. Im Nu stieben die andern ebenso auseinander, und in wenig Augenblicken haben sie sich dann alle fünf auf ihrem Tummelplatz wieder vereinigt, um das hübsche Spiel von neuem zu beginnen.
Die Sonne ist untergegangen; grau senkt sich die Dämmerung über die Heide. Da erscheint der Kopf der alten Füchsin im Höhleneingang; mit Lauschern und Windfang prüft sie vorsichtig, ob alles ganz sicher sei, fährt knurrend wieder zurück, weil etwas im Kieferngeäst raschelt – ein Vogel, der sein Schlafplätzchen sucht – doch endlich steht sie im Freien. Sie streckt sich, schüttelt den Sand und den Staub aus ihrem rothaarigen Wams, leckt und liebkost die Kinder, die sich herandrängen, und beteiligt sich schließlich auch ein wenig an dem muntern Spiel, da die Kleinen gar so sehr betteln.
Eine gute Figur macht die Alte um diese Jahreszeit nicht; sie ist dürr und hager am ganzen Leib, und der Pelz ist verdrückt, am Bauche sehr schütter und nicht mehr so frisch in den Farben. Das ist kein Wunder; fünf Kinder auf einmal! Sie wollen alle gesäugt und gewärmt sein, da kommt man schrecklich herunter. Wochenlang konnte die Füchsin nur auf Stunden den dunkeln Bau verlassen, um den nagenden Hunger zu stillen. Und wenn sie nichts anderes fand, als nur ein paar Mäuschen oder irgendeinen Kleinvogel, so mußte sie kaum halbgesättigt zu den ungeduldigen Kindern zurück; die verlangten nach Speise und fragten nicht, ob auch der Mutter eine Mahlzeit geworden. Seit acht oder vierzehn Tagen sind nun die Kleinen entwöhnt. Das war nicht so leicht; immer und immer wieder suchten sie nach dem Milchquell, wenn auch die Mutter ärgerlich knurrend sie gar unsanft zurückstieß. Die von Tag zu Tag[116] fester zupackenden Zähnchen konnte die Fähe an dem zarten Gesäuge aber nicht länger ertragen, und so gab's manchen Klaps mit den Pfoten, und das Fell wurde den Kindern oftmals ganz tüchtig geschüttelt, bis sie schließlich begriffen, daß die Tauben und Hühner, die jungen Karnickel oder die Mäuschen, die die Mutter mit heimbrachte, den Hunger ebenso stillen.
Jetzt gießt der aufgehende Mond sein silbernes Licht über die schlafende Heide; da denkt die Alte: nun ist's Zeit für den Pirschgang! Sie wittert nochmals nach allen Seiten; dann schleicht sie davon, zwischen dem Pflanzengestrüpp leise dahinkriechend, daß der Bauch fast den Boden berührt. Ein paarmal fährt sie knurrend zurück, wenn eins der Kleinen ihr zu folgen versucht, aber bald ist sie unter den Ästen der jungen Kiefern verschwunden. Nun seid auf der Hut, ihr Bewohner des Feldes, ihr Mäuse, Hamster und Maulwürfe, die ihr gleichfalls so gern zur nächtlichen Stunde aus eurer Wohnung hervorkommt: der böse Feind ist hinter euch her! Oder ihr Fasanen- und Rebhuhnmütter, wie wird's euch ergehen! Der Fuchs schleicht leise heran, die Nase immer gegen den Wind, daß er die Beute von fern schon wittert – ein Sprung, ein fester Griff, und ihr seid in seiner Gewalt! Dem Junghäschen, das in einer Feldfurche schläft, dem unerfahrenen Karnickel, das draußen am Waldrand noch im Mondschein äst, der Ratte, die am Schweinekoben des Bauernhofs sich zu schaffen macht, ergeht es nicht besser, und wehe den Hühnern und Gänsen, wenn der Geflügelstall nicht ganz gut verwahrt ist!
Sobald die Füchsin eine Beute gemacht hat, kehrt sie zu ihrer Wohnung zurück; an ihre Kinder denkt sie[117] immer zuerst; meist wird es Morgen, ehe sie den eignen Magen befriedigt. Aber wie vorsichtig ist die Fähe, wenn sie sich dem Bau nähert! Nie wird sie den geraden Weg nehmen; sie umkreist vielmehr, oft stehenbleibend und lauschend, in weitem Bogen ihr Heim. Wittert sie irgend etwas Verdächtiges, so kläfft sie, ähnlich wie ein Hund, doch mit verhaltener Stimme, daß sich die Füchslein in den schützenden Bau flüchten; erst wenn ihr alles ganz sicher erscheint, schleicht sie heran. Das ist dann eine Freude! Die hungrigen Kinder fallen über die leckere Beute her, balgen und beißen sich drum, und jedes sucht das beste Stück zu erwischen.
Ein Weilchen schaut die Mutter ihrer munteren Schar zu, hilft wohl auch beim Zerlegen des Bratens; aber dann tritt sie von neuem den nächtlichen Pirschgang an. Sind alle gesättigt, daß sie mit den Resten der Mahlzeit nur noch ihr ausgelassenes Spiel treiben, so holt die Füchsin vom Felde vielleicht noch ein lebendes Mäuschen, und nun geht es dem graufelligen Tierchen nicht anders, als wenn eine Katze es erwischt und ihren Jungen gebracht hätte.
So kommt der Morgen heran. Schon jubelt die Drossel, Rotkehlchens Lied, die weiche Stimme des Fitis durchzittert die Luft, und hell schmettert der Fink seine Fanfare – da zieht sich die ganze Gesellschaft, eins nach dem andern, still in die Höhle zurück; sie schlafen hier bis gegen Abend. Nur manchmal währt die Ruhe ein oder dem andern vorwitzigen Fuchskind zu lang. Es schaut dann zu dem Höhleneingang sehnsuchtsvoll hinaus, blinzelt mit den listigen Augen – die Sonne scheint ihm auch gar zu hell ins Gesicht – und schließlich versucht es ein Schläfchen, mitten im Toreingang zur unterirdischen[118] Burg, wie sein zahmer Vetter, der Hofhund, der die Vorderpfoten zur Tür seiner Hütte herausgestreckt hat und nun gemütlich schlafend mit Schnauze und Kopf auf diesem natürlichen Kissen ruht. Bisweilen wagen sich die Jungfüchse auch schon mittags auf ihren Spielplatz, wenn die Maisonne hoch vom Himmel zwischen den schlanken Stämmen auf den Fuchsbau herabscheint; aber wirklich lustig wird's doch immer erst gegen Abend.
Sind die Füchslein ein paar Monate alt, so dürfen sie die Mutter auf ihren nächtlichen Streifzügen begleiten, zuerst bis zum Waldrand, später weiter hinaus ins Saatfeld, ins Röhricht am Weiher, oder gar bis zu den ersten Bauerngehöften des Dorfes.
Wie man das Karnickel beschleicht, einen Junghasen würgt, den schlafenden Vogel erwischt, zeigt ihnen die Alte. Sie begreifen gar schnell; denn es liegt ihnen im Blut, sich mäuschenstill heranzupirschen, jede Deckung zu benutzen und selbst in der Freude über den gelungenen Raub keinen Augenblick die eigene Sicherheit aus dem Auge zu lassen.
Ein Vierteljahr mögen die Geschwister alt sein oder wenig darüber, da unternehmen sie bereits auf eigene Faust kleine Streifzüge. Sie stellen sich gegen Morgen gewöhnlich in der gemeinsamen Kinderstube wieder ein; aber gelegentlich suchen sie auch ein anderes Versteck auf.
So lösen sich ganz allmählich die Beziehungen zwischen Mutter und Kind und zwischen den Spielkameraden. Wenn der Herbststurm durch die kahle Heide braust, kennt keins das andere mehr, jedes geht nun seine eigenen Wege und schlägt sich selbständig durchs Leben, das ihm der Gefahren so viele bringt.
Und der Vater?
Er kümmert sich um seine Familie fast gar nicht und ist selten zu Hause; kommt er einmal, gleich gibt's Zank, Beißen und Kläffen zwischen den Eltern, und die Mutter ruht nicht eher, als bis Vater Reineke wieder »verduftet«, in des Worts vollster Bedeutung.
Die Erziehung der Kinder liegt allein auf den Schultern der Fähe; der Rüde hält von Pädagogik nicht das geringste. Seine Losung heißt: »Selber essen macht fett«; darum sieht er auch im Frühjahr wohlgenährt aus, und tadellos ist sein rotbrauner Pelz. Nur wenn die Alte durch ein herbes, Geschick den Jungen geraubt ward, mag es bisweilen vorkommen, daß sich die Väter der vor Hunger kläffenden Kinder erbarmen und ihnen Futter zuschleppen.
Zur Osterzeit gibt's immer junge Füchslein im bewohnten Bau, meist fünf bis sechs, einmal waren es sogar acht.
Möge sich dieser Kreislauf des Lebens mit jedem Lenz, wenigstens hie und da, in unsern deutschen Forsten erneuern!
Es wäre traurig, wenn man ihn ganz ausrottete, den listigen, Ränke schmiedenden Schelm! Dann würde wohl der Förster unsre Enkel an eine Stelle im Wald führen und ihnen erzählen: »Hier färbte die rote Tinte den letzten Fuchs im Revier; man hat ihm das hübsche Denkmal gesetzt wie drüben im Nachbarrevier seinem Vetter, dem Wolf!« Aber mit dem fröhlichen Leben, dem ausgelassenen Spiel vor Malepartus, der Raubburg, wär's dann für immer vorbei.
Ob wohl ein oder der andere meiner Leser schon einmal junge Igel gesehen hat, so im Alter von fünf oder sechs Wochen? Das sind die niedlichsten Dinger der Welt, die man sich denken kann, und es lohnt schon der Mühe, im Spätsommer Gärten und Hecken, Parkanlagen, lichte Laubwälder und namentlich Feldgehölze ein bißchen zu durchstöbern, um – wenn man Glück hat – die reizendste Familienidylle zu belauschen: eine Igelmutter, die ihre vier oder fünf Kinder spazieren führt.
Wie das im Laub raschelt von all den trippelnden Füßchen, und wie schnell die kleinen, kurzen Beinchen laufen können, wenn die stachlige Mutter einen Regenwurm entdeckt hat und ihn aus dem Versteck hervorzieht, um die kleine Beute den lüsternen Kindern zu überlassen. An jedem Ende des Unglücklichen zerrt eine der niedlichen Stachelkugeln – zusammengerollt ist sie nicht größer als ein Billardball – während ein drittes Igelchen den straff gespannten, in die Länge gezerrten Wurm mit den weißen Zähnchen zerbeißt, um schließlich für seine Mühe nichts zu erhalten als ein Tröpfchen Saft, das sich der Kleine wohlgefällig von dem dunkeln Schnäuzchen ableckt.
Da ist ein Mäusebraten schon eine standfestere Grundlage der Mahlzeit, von der doch jedes der Kinder ein[121] Stückchen bekommt. Man muß es selbst gesehen haben, wie schnell die Igelmutter hinter dem kleinen Nager her ist, wenn sie dessen leises Pfeifen oder das fast unhörbare Rascheln im Bodengestrüpp gemerkt hat. Einen Augenblick verharrt die Alte in gestreckter Haltung; die Kopfstacheln sträuben sich ein wenig, senken sich und sträuben sich wieder. Ein paar Schritte schleicht sie vorwärts, und jetzt ein kleiner Satz ins Gestrüpp. Mit sicherem Griff ist das Mäuschen gepackt; ein kurzer Aufschrei, und das Genick des kleinen Nagers ist zerbissen. Hurtig wird das Wildbret von der schnaufenden Mutter in mehrere Teile zerlegt, und bald sitzt jedes der Kinder knuspernd und leise schmatzend vor seinem Stückchen, während die Alte weiter trippelt, nach neuer Beute zu schauen. Ein Maulwurf wäre kein schlechter Fang; aber den erwischt man nur am dämmernden Abend. Eine Schermaus wäre gleichfalls willkommen; aber schließlich tun's auch ein paar Mist- oder Brachkäfer, Ackerschnecken, Schmetterlingspuppen, eine fette Werre, und wohlgenährte Regenwürmer fehlen fast nirgends.
Nichts Trolligeres gibt es, als zu sehen, wie es die kleinen naseweisen Igelchen der Mutter nachmachen – was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten. Überall kratzen und scharren sie mit ihren krallenbewehrten Pfötchen; in jedes Loch am Boden, in jeden Winkel zwischen dem Wurzelgeflecht und Pflanzengewirr stecken sie schnuppernd ihr Schnäuzchen, hängen der Mutter am Rock, wenn sie glauben, jetzt hat sie 'was Gutes gefunden, oder sie gehen auch schon ihre eignen Wege, den Steilhang hinauf, von dem eins der Kindchen wieder herabkugelt, trinken vom Wasser, das sich zwischen den Baumwurzeln angesammelt hat, und schauen[122] verdutzt dem Roßkäfer nach, der vor ihrem Näschen vorbeisurrt. Wenn es noch heutzutage irgendwo, wie im Märchen, eine Prinzessin gibt, die niemals in ihrem Leben gelacht hat, ich würde sie zu solch kleiner Igelgesellschaft führen; da lernte sie aus Herzenslust lachen.
Einst beobachtete ich eine Igelfamilie an einem Wiesenhang, wo ein vom Baum gefallener Apfel die Aufmerksamkeit der stachligen Gesellschaft auf sich lenkte; von Obst aller Art sind ja die Igel große Freunde. Durch einen unvorsichtigen Stoß kam der Apfel ins Rollen; sofort sausten die Kleinen hinter ihm her, überstürzten sich aber und kugelten lustig den Hang hinab, wie wir's als Kinder auch so gern taten. Unten lag dann der Apfel im Graben am Wege und drei Igelchen neben ihm. Schnell rollten sich diese auf und hatten bereits tüchtige Löcher in die süße Frucht gefressen, als endlich auch die Mutter mit den beiden Geschwistern ankam, die von oben her dem lustigen Treiben zugeschaut hatten.
Man sagt, der Igel trage abgefallenes Obst in der Weise in sein Versteck, daß er es auf seine Stacheln spieße; wo viel Birnen oder Pflaumen im Obstgarten liegen, da wälze er sich am Boden, und mit der willkommenen Last trolle er heim. Natürlich ist das Ganze ein nett ersonnenes Märchen. Weder mit dem Schnäuzchen, noch mit den Füßen kann der Igel seinen Rücken erreichen; wie sollte er also das Obst fressen oder auch nur abstreifen können? Als Junge habe ich einmal mit den grünen Früchten der Kartoffel – wir nannten sie »Kartoffelschneller« – nach einem Igel geworfen. Eins der ungefährlichen Geschosse blieb an seinem Stachelkleid hängen. Das machte mir solchen Spaß, daß ich mir den[123] Igel fing und ihm im Übermut seinen ganzen Rücken mit dem seltsamen Zierrat besteckte. Dann ließ ich ihn laufen. Am folgenden Tag sah ich ihn wieder, und da trug er noch immer eine Anzahl der grünen Beeren auf seinem borstigen Kleid. Nicht den geringsten Versuch machte er, sich von dem aufgedrungenen Schmuck zu befreien.
Das Volk fabelt ferner, der Igel trage, wenn er sich sein Winterlager zurechtmache, auf seinen Stacheln all die Stoffe zusammen, die ihn wärmen sollen, Stroh, Laub, Moos u. dgl. Das ist auch nicht wahr. In die natürliche oder selbstgegrabene Höhlung kratzt und schiebt er diese Dinge mit Füßen und Schnäuzchen hinein und verwahrt besonders den Eingang. Aber solch fester Winterschläfer, wie Bilch oder Haselmaus, ist der Igel durchaus nicht, habe ich ihn doch mehr als einmal mitten im Schnee angetroffen, wo er ganz lustig einhertrippelte.
In einem unterirdischen oder wenigstens gut versteckten Lager zwischen trockenem Laub, Gräsern und sonstigem Pflanzenwust werden die Swinegelchen geboren. Anfangs sind es kleine, rosige Dinger, blind und zahnlos und die winzigen weißlichen Stacheln ganz weich – es wäre auch sonst bei der Geburt höchst unangenehm gewesen für Mutter und Kind. Die Alte muß auf der Hut sein, daß sie die vier oder fünf zarten Jungen mit ihren nadelspitzen Stacheln nicht verletzt; sie deckt die Kleinen mit den ziemlich weichen, rötlichgelben Haaren ihrer Bauchseite, zwischen denen die Milchdrüsen liegen. Tagsüber ist säugen ihr Geschäft; in der Nacht geht sie jagen. Die ganze Last der Kindererziehung liegt auf ihren Schultern; der Papa lebt getrennt von der Familie, ein rechter Einsiedler und[124] Griesgram, und von Erziehung will er nichts wissen. In dem warmen Lager, von der zärtlichsten Mutter behütet, wachsen die Kleinen sehr schnell heran. Schon sind sie mit spitzen Stacheln und scharfen Zähnchen bewaffnet, hell blicken die Äuglein, die Füße trippeln so hurtig: bereits ganz Papa und Mama, nur klein noch und zierlich. Wir können der Versuchung nicht widerstehen und nehmen eins der Tierchen in die Hand – eine Roßkastanie in stachliger Hülle. So leicht ist die Kugel, daß wir uns an den Spitzen nicht verletzen können. Wie wenig schüchtern der kleine Kerl doch ist! Es dauert nicht lange, so rollt er sich auf, beschnüffelt unsre Finger und verschwindet schließlich im Rockärmel. Wart', Kleiner, du sollst belohnt werden! Etwas lauwarme Milch, in ein Näpfchen gegossen, wird sofort gierig geschlürft. Dann trollt unser Igelchen weiter. Sie werden's schon wiederfinden hier an der Hecke oder dort im Gestrüpp des Unterholzes zwischen den Bäumen.
Unter den freilebenden Vierfüßlern unsrer Heimat gibt es kaum ein anderes Tier, das ich so gern habe wie den Igel, keine interessantere Gesellschaft als eine Igelfamilie. Gesetzt, die Natur hätte den stachligen Gesellen nicht geschaffen, die kühnste Phantasie des Menschen würde sich solch' abenteuerliche Gestalt niemals ausgedacht haben. Zwei besondere Eigenschaften sind es, die der Igel vereinigt: das stachlige Kleid und die Kunst, sich zusammenzurollen. Und diese beiden Eigenschaften machen ihn zu einem der merkwürdigsten, seltsamsten, ja wunderlichsten Geschöpfe.
Erfindungsreich ist der Mensch, in unserer Zeit namentlich auch auf sozialem Gebiete. Aber alle Erfindungen haben wir doch schließlich der Natur abgelauscht:[125] die Ruder und das Steuer des Bootes den Flossenträgern, die Bereitung des Holzpapiers den Wespen, und das Neueste, mehr auf geistigem Gebiete gelegen, die »passive Resistenz« dem Igel. Kein anderes Tier bringt diese moderne Methode der Abwehr, der Verteidigung besser zum Ausdruck, und der Erfolg lehrt ihre Berechtigung. Den Stärkeren angreifen? nein. Oder sich mit Krallen und Zähnen verteidigen? warum denn? Kann man es wissen, wie's endet? Ich ziehe mich lieber in mein Innerstes zurück, schließe mich von der rauhen Außenwelt ab. Ich bin die Welt, ich allein; mein Wille regiert. Schau du zu, wie du mich faßt! Deine Sache ist's, wenn du dir die Finger blutig stößt oder die Schnauze, Gesicht, Nase und Augen! Mach' mit mir, was du willst, ich habe Zeit und Geduld; wollen mal sehen, wer's länger aushält, ich oder du?
Vor uns liegt der kuglige Ballen auf dem Tisch der herbstlichen Laube. Hei, wie das springt von winzigen Flöhen zwischen den Stacheln und hoch in die Luft hinauf, ein Dunstkreis fröhlichen Lebens! Glaube nicht, daß er's fühlt, all das Gekribbel, Gekrabbel. Ein schrecklicher Zustand wär's, wie ihn wohl die mittelalterlichen Ritter in der schweren Eisenrüstung gekannt haben: jetzt zwickt es hier, und jetzt juckt es da, und man kann sich nicht kratzen! Unbeweglich die Kugel, nur leise atmet's im Innern, sanft hebt und senkt sich die Wölbung – kreuz und quer stehen die Stacheln, durchaus nicht in der Richtung der Radien. Bald legt sich einer nieder, ein anderer richtet sich steiler empor, von unsichtbarer Kraft bewegt; denn es treten mehrere Hautmuskeln an jeden einzelnen Stachel heran. Auf der Mitte des Rückens sind die nadelspitzen Gebilde am längsten,[126] 2 cm etwa oder noch etwas mehr. Hübsch gezeichnet sind sie: in der Mitte lichter, am Grund und namentlich an der Spitze viel dunkler; doch gibt's auch hellere Igel mit gelblichen Stachelspitzen, also Brünette und Blonde, wie unter uns Menschen. Vollkommen stielrund sind die Stacheln nicht; sie zeigen Längsfurchen, den Blutrinnen an den Säbeln und Seitengewehren zu vergleichen. Aber so fein sind diese Furchen, daß wir genau zusehen und den Kopf drehen und wenden müssen, um sie bei verschieden auffallendem Lichte zu erkennen. An einem Querschnitt kann man mittels der Lupe leicht feststellen, daß etwa 25 Längsrinnen an jedem Stachel hinziehen, bald mehr, bald weniger. Zwischen den Stacheln stehen weißgraue bis rostgelbe Borsten, besonders nach den Seiten zu; ja am Bauche und im Gesicht, an den Schenkeln und Füßen, wovon freilich jetzt nichts zu sehen ist, haben diese borstigen Haare die Alleinherrschaft. Stacheln wären dort nur vom Übel.
Schon währt's uns zu lange. Willst du dich nicht endlich in deiner natürlichen Gestalt zeigen, du Trotzkopf? Wir drehen die Kugel vorsichtig um, daß sie auf dem Rücken liegt. Aber nur enger und fester zieht sich der Igel zusammen. Mit Gewalt ist auch nichts zu erreichen. Der mächtige Hautmuskel, der wie ein Mantel oder eine Kapuze vom Rücken her das ganze Tier umgibt, ist kräftiger als unsre Hand; je mehr wir uns mühen, auch mit Nichtachtung der stechenden Stacheln die Kugel auseinander zu bringen, um so fester schließt sie sich. Biegsam wie eine Weidenrute muß die Wirbelsäule unsres Freundes sein, und auch dafür, daß sie bei dieser Zusammenrollung nicht zu stark auf das Rückenmark drückt, hat die Natur gesorgt. Schon in den Brustwirbeln[127] löst sich dieses in Einzelstränge auf, die den Druck leichter vertragen.
Aber jetzt greifen wir zu einem teuflischen Mittel, denn erschöpft ist unsre Geduld. Tabak und Stummelpfeife kommt her! Blaue Wolken steigen empor, die Luft mit Wohlgeruch füllend; denn Pfälzer ist's, edles Gewächs. Wie sie springen, die Flöhe! Wirst uns noch dankbar sein für die Entlausung! Lebhafter bewegen sich jetzt die einzelnen Stacheln; wie eine Welle läuft's dann ganz leise über die Rundung. Die Kugel dreht sich allmählich und löst sich ein wenig; der Rücken zeigt wieder nach oben. Der ambrosische Duft, an den der Nichtraucher so gar nicht gewöhnt ist, scheint ihm nicht zu behagen. Noch ein kräftiger Gasangriff von unten her, tief hinein zwischen die borstigen Haare, und unser Igelchen streckt sich ganz sacht und verstohlen; niemand soll's merken, daß es endlich nachgeben will. Schon schaut ein Füßchen hervor mit fünf starken Nägeln, zum Graben und Scharren geschaffen, jetzt ein zweites und vorn ein niedliches Schnäuzchen; schnuppernd hebt sich's aus der stachligen Kugel. Jetzt zeigt sich schon das Gesichtchen. Prächtige Physiognomie! So naseweis und verschmitzt, und so lustig blitzende Äuglein, wie schwarze Perlen auf lichtem, graubaunem Grunde. Fein sind die Ohren gebildet, alles niedlich und spitz: das Näschen, die dunklen Schnurren, die feinen Stichelhaare im Antlitz, darüber ein Wall längerer Borsten, einem Helm zu vergleichen. Aber das Hübscheste bleibt doch das verlängerte, vorn etwas aufgeworfene Schnäuzchen, das sich schnüffelnd bald aufwärts wendet, bald abwärts, bald nach links, bald nach rechts. Es bildet die verlängerte und freibewegliche Nase, zugleich ein Tastorgan von[128] höchster Vollkommenheit. In der Haut der beweglichen Rüsselscheibe drängen sich nämlich unzählige Tastkörperchen zusammen, mit denen der nächtliche Jäger die Gegenwart oder die Nähe seiner Beute unter dem Laube, im feuchten Boden, im Mull von Baumhöhlen gewissermaßen »schmeckt«, noch ehe er sie erreicht hat, gleich der Waldschnepfe, die mit ihrem Stecher würmt, an dessen empfindlicher Spitze ebenfalls Hunderte von Nervenendkörperchen sitzen, die dem Vogel die leichteste Erschütterung des Erdbodens anzeigen.
Von meinem Pfälzer, das kann ich mir denken, ist die feine Nase des Igels nicht begeistert; er trippelt deswegen auf seinen niedrigen Beinen an die andre Seite des Tisches, um frische Luft zu schöpfen, wobei er uns den Genuß gewährt, auch sein winziges Schwänzchen zu bewundern, das steif schräg nach unten gerichtet ist, wie das kurze, fest zusammengedrehte Zöpfchen eines kleinen Mädels. Über den Geschmack ist nicht zu streiten und über den Geruch ebensowenig. Und ob dem unverbesserlichen Nikotinverächter der Rauch meines edlen Krautes noch unangenehmer ist als uns der Bisamduft, den er im zeitigen Frühjahr ausströmt, wenn er der Gattin den Hof zu machen pflegt, das können wir nicht entscheiden. Der Igelin freilich scheint der parfümierte Ritter zu gefallen; ihr ist's lieber, als wenn er sich ein Sträußchen Parmaveilchen angesteckt hätte. »Wat dem einen sin Uhl, is dem annern sin Nachtigall«. Aber nun komm wieder ins Tuch, in dem wir dich hergebracht haben! Wir klopfen mit dem Stock auf den Tisch, sofort rollt sich die Kugel zusammen. Wir bringen sie nun zurück zur Hecke, von wo wir sie holten. Ein paar Minuten noch, und der Igel trollt ab.
Schade, daß wir ihm nicht in den Mund sehen konnten; dort stehen perlenartig aneinandergereiht 36 der niedlichsten Zähne. Denk ich sie mir zu den Maßen eines Löwengebisses vergrößert, ein schauderhaft mächtiges Zerstörungswerk würde es sein, obgleich die Eckzähne fehlen. Oben und unten 6 Schneidezähne, schräg nach vorn gerichtet, dann jederseits oben 2 Lückenzähnchen, unten nur eins, scharf wie ein Meißel, und endlich die Backzähne, 5 oben, 4 unten auf jeder Seite, mit scharfspitzigen Höckern versehen, so recht zum Zermalmen der Beute. Die stärksten Knochen der Maus und der Ratte, des Frosches, der Eidechse, die Chitinringe der Insekten, selbst Brustharnisch und Flügeldecken des Hirschkäfers zersplittern wie Glas zwischen dem festen Gebiß, und auch größeren Schlangen zerbeißt der stachlige Räuber im Nu die Wirbel.
Es ist bekannt, daß sich der Igel selbst vor der Kreuzotter nicht fürchtet und die bösartige Schlange sehr schnell bewältigt und auffrißt. Man sagt, er sei gefeit gegen ihr Gift, genau wie der Storch. Beides ist nicht ganz richtig. Unser Hausfreund, der Storch, frißt die Kreuzotter nur deshalb ungestraft, weil er es versteht, ihr mit dem Bajonettschnabel den Kopf zu zermalmen, bevor sie imstande ist, ihren Feind mit den Giftzähnen zu verletzen. Wohin sollte sie ihn auch beißen? In die Ständer, den Schnabel? Die Haut dieser Glieder führt wenig Blutgefäße, und die Gefahr einer Vergiftung wäre gering. Ähnlich wie der Storch macht es der Igel. Flink und gewandt zerbeißt er dem unheimlichen Kriechtier Kopf und Genick. Freilich muß er schon etwas Erfahrung besitzen, wenigstens fallen junge Igel, wenn man sie zu einer Kreuzotter bringt, dieser gewöhnlich[130] zum Opfer, nicht aber alte, erfahrene Herren. Die getötete Schlange zu fressen, ist ungefährlich, kein Fakirkunststück; denn im Verdauungskanal ist das Gift ganz unschädlich. Es wirkt nur, wenn es ins Blut kommt. Gewiß ist die Widerstandskraft gegen das Schlangengift beim Igel größer als bei andern Warmblütern. Der Jahrtausende währende Kampf, den er gegen die Otter führt, hat ihn ziemlich giftfest gemacht; aber wirklich gefeit, wie manche wohl glauben, ist er durchaus nicht. Igel, die man von Kreuzottern in Zunge und Mundwinkel beißen ließ, wurden ziemlich krank und litten tagelang an den Folgen der Vergiftung; sie gesundeten aber später wieder vollkommen. Auch unmittelbaren Gifteinspritzungen setzten sie großen Widerstand entgegen. Die Dosis, die ein Meerschweinchen schnell tötet, muß verzehnfacht werden, ehe ein Igel nur vorübergehend erkrankt. Auch andere natürliche Gifte verträgt unser Stachelträger sehr tapfer; so macht er sich gar nichts daraus, auch einmal ein paar grüne Spanische Fliegen zu fressen, deren Genuß bei andern Tieren den Tod, wenigstens fürchterliche Schmerzen im Rachen und in der Speiseröhre verursacht.
Pflanzenkost verschmäht der Igel aber auch nicht. Obst, das sahen wir schon, ist ihm eine Lieblingskost, ebenso Beeren aller Art, desgleichen saftreiche Wurzeln, wie Mohr- und Steckrüben; ob er auch Schwämme verzehrt, kann ich nicht sagen. Reich ist der Speisezettel, den Mutter Natur für ihn bereit hält. Nur das eine sollte der Gefräßige lassen, nämlich das Plündern bodenständiger Nester; dadurch schadet der Igel vielleicht mehr, als man denkt. So mancher Forstmann klagte mir schon, daß der Bursche Fasaneneier getrunken, junge Schnepfen[131] gefressen, ja Rebhuhneier, während die Henne darauf saß und sie heftig verteidigte, zu rauben versucht habe. Selbst junge Häschen sollen ihm bisweilen zum Opfer fallen (?). Und der Strafe entzieht sich der stachlige Raubritter stets; sofort ist die Kugel gebildet: greife mich an, wenn du's wagst! Nur dem Uhu darf er's nicht sagen. Der kümmert sich nicht drum. Mit seinen wehrhaften Krallen packt er kühn zwischen die Stacheln, und mit dem mächtigen Schnabel löscht er dem Igel das Lebenslicht aus.
Eigentlich sollte man meinen, die Verminderung der Raubvögel müsse den Igeln zugute kommen wie etwa den Mitgliedern der Krähensippe oder den Spechten. Mag sein, aber andre feindliche Kräfte sind am Werk, diesen Vorteil aufzuheben; es scheint mir, man begegnet heute viel seltener einmal einem Igel, als in früheren Zeiten. Der Jäger ist ihm feindlich gesinnt; ja manche Jagdschutzvereine hatten früher den Igel mit in die Liste des Raubzeugs aufgenommen, für dessen Erlegung Belohnungen gezahlt wurden. Gegen jede Verfolgung sollten aber die Landwirte entschieden Einspruch erheben, denn für sie ist der Igel als treuester Verbündeter gegen die Mäuse ein sehr nützliches Tier. Vier, sechs Feldmäuse zu einer Mahlzeit mit Haut und Haar zu verzehren, ist ihm eine Kleinigkeit, und auf Insekten hat er immer Appetit; solch kleines Getier ist überhaupt nicht zu rechnen, denkt er bei sich.
Nur in einer Beziehung ist der Igel genügsam, im Trinken. Es muß schon recht heiß sein, ehe er einmal aus einer Pfütze am Wege trinkt oder aus einem der kleinen Wasserbecken, die der Wald zwischen dem oberirdischen Wurzelgeflecht der Bäume für seine durstenden Bewohner[132] allzeit bereit hält. Auch die Igel, die ich tage- und wochenlang in Gefangenschaft hielt, haben nur selten von dem Wasser geleckt, das ich nie versäumte, in den Raum zu stellen, den ich ihnen anwies. »Mit Wasser bleib mir ferne!« scheint ihr Losungswort zu sein. Sie verhalten sich also ähnlich wie die meisten Raubvögel, die ja auch zugleich mit ihrer blutigen Kost so viel Flüssigkeit aufnehmen, daß sie tagelang des Wassers entbehren können, obgleich es auch Ausnahmen gibt. So tauchte ein Schleierkauz jedes Stückchen Fleisch, das ich ihm gab, ins Wasser, ehe er's verschlang. Merkwürdig ist's, daß die Igel, die alten wie die jungen, sehr gern etwas Milch schlürfen, wobei sie wohlgefällig schmatzen, so gut schmeckt es ihnen.
Wollten wir als Kinder einen Igel, wenn ich so sagen darf, »aufwickeln«, so kannten wir bei dem streng befolgten Rauchverbot nur zwei Mittel. Das eine war Musik. Wir machten in seiner Nähe durch Trommeln auf der Gießkanne einen Höllenspektakel. Aber das Mittel versagte bisweilen; denn oft zog sich Meister »Struppig« nur noch enger in sein Innerstes zurück: »Lärmt wie ihr wollt, ich halte meine Öhrlein verschlossen!« Das andere Mittel wirkte schneller und sicherer: ein tüchtiges Brausebad. Mitunter haben wir die stachlige Kugel auch den Wiesenhang hinabgekollert, geradenwegs in den Bach und uns dann teuflisch belustigt, wie sich der Igel im Wasser sofort aufrollte und, obgleich er's nie gelernt, doch äußerst geschickt, das Näschen über dem Wasser haltend, nach einer Stelle am Ufer schwamm, wo er am leichtesten wieder festen Grund unter den kleinen Füßen fassen konnte. So völlig durchnäßt, rollte er sich nie wieder sofort zusammen, sondern[133] ließ uns ruhig seine ganze Person betrachten, den Kopf, die Füße, das Schwänzchen. Die Nässe des Unterleibs war offenbar seinem Schnäuzchen viel zu unangenehm, als daß er es zwischen den triefenden Borstenhaaren versteckt hätte. Auch der Fuchs soll den Igel ins Wasser rollen, um ihn dann zu bewältigen. Ob es wahr ist, weiß ich freilich nicht.
Den Igel zu essen, fällt bei uns niemand ein, obgleich sein fettes Fleisch im Herbst gewiß ebenso gut schmecken mag, wie das des Dachses, mit dem er ja in der Lebensweise wie in der äußeren gedrungenen Gestalt manches gemein hat. In Spanien hat man ihn ehemals während der Fasten häufig gegessen; ich möchte die Ausrede kennen, die man gebraucht haben mag, um solchen Fleischgenuß zu rechtfertigen. Bekannter ist die Vorliebe der Zigeuner für einen Igelbraten. Im Lande der Stephanskrone war ich einst Zeuge, wie sich die braunen »Söhne Pharaos« auf dem Felde ein Igelgericht zubereiteten. Drei Stück, die sie gefangen und erschlagen hatten, wurden von den urwüchsigen Gesellen notdürftig ausgeweidet, dann wieder zu einer Kugel zusammengerollt, mit feuchtem Lehm dick umgeben und schließlich in der glühenden Asche gebacken, wie Schinken in Brotteig. Als nach geraumer Zeit der Lehm zu bröckligem Ziegel gebrannt war, stieß der Oberkoch mit dem Fuß die heißen Klumpen aus der Asche heraus und zerschlug die Umhüllung. Die Stacheln und die meisten harten Borsten blieben in ihr stecken. Was mit dem toten Ungeziefer geschah, das weiß ich nicht, ging mich auch weiter nichts an. Mürb war der Braten und saftig, und er schmeckte dem genügsamen Völkchen allem Anschein nach großartig.
Mancher Igel hat in früheren Zeiten auch für die Gesundheit des Menschen sein Leben lassen müssen; denn der Igelleib bot bei dem oder jenem Gebreste der leidenden Menschheit so manches sicher wirkende Heilmittel. Selbst dem Gewerbe kam die stachlige Haut zu statten; sie diente im alten Rom zum Karden der wollenen Tücher, desgleichen als Hechel. Auch noch später bildete sie zu ähnlichen Zwecken einen Handelsartikel.
Das Volk will zwei Abarten des Igels unterscheiden: »Hundsigel« und »Schweinsigel« – der letztere ist der bekanntere, schon wegen des reizenden Märchens »Swinegel un sine Fru«. Der Zoolog aber kennt bei uns nur die eine Spezies: Erinaceus europaeus. Freilich in Südostrußland, in den Niederungen um den Kaspischen See und östlich bis zum Baikalsee kommt noch eine andre Form vor mit etwas längeren Ohren und kürzerem Schwanz, unten sehr hell behaart, sonst unserm europäischen Igel ganz ähnlich. Erinaceus auritus, langohriger Igel nennt ihn der Zoolog.
Unser Landsmann ist in fast ganz Europa heimisch, mit Ausnahme der nördlichsten Länder, etwa vom 63° n. Br. an. Auch die waldreichen Gebirge bewohnt unser Igel; in den Alpen steigt er bis gegen 1500 m an, im Kaukasus gar bis 2000 m. Die Wälder und Fruchtauen, die Felder und Gärten der Ebenen und Hügelländer sind ihm aber doch lieber. Sehr zahlreich kommt er in den weiten russischen Ebenen vor, auch im nördlichen Asien ist er verbreitet. Dort und namentlich in Afrika stellen sich dann auch manche andere Arten der stachelborstigen Familie ein. Das Stachelschwein aber, das seine Heimat in den Mittelmeerländern hat – in Nordwestafrika, in Griechenland und in Süditalien bis[135] nordwärts zur römischen Campagna trifft man es an – gehört nicht hierher, sondern zu den Nagetieren.
Im Verborgenen führst du dein Leben, du seltsamer Einsiedler, drolliger »Bruder im stillen Busch«, von den Menschen wenig beachtet, von vielen verkannt. Nur einen Ort weiß ich, der bringt dich zu Ehren, ja er nennt sich nach dir, Iglau in Mähren. Er hat sich dein Konterfei ins Wappen gesetzt, wie Griechenlands Hauptstadt die Eule, das Sinnbild der Pallas Athene. Lustige Igel sind's in dem einen Feld, in dem andern aber züngelnde Löwen mit aufgerissenen Rachen. Noble Gesellschaft, nicht wahr? Laß sie nur spotten, die andern Tiere des Waldes: struppiges Stacheltier, Borstenträger, Schweinigel und wie sie dich schimpfen – du gabst der Stadt ihren Namen und nicht der König der Tiere!
Die nächsten Verwandten des Igels, die Spitzmäuse, sind Gnomengestalten, die kleinsten unter den Säugetieren; ja das winzigste Geschöpfchen, die Zwergspitzmaus, wird nur 9 cm lang, wobei das Schwänzchen sogar mitgerechnet ist, und die häufigste Art, unsre Waldspitzmaus, ist auch nicht viel größer: 11 cm, wovon reichlich 4 cm auf den Schwanz kommen; der kleine Finger des Menschen ist meist noch etwas größer. Alles ist zierlich an diesem Zwergengeschlecht: das rüsselartig verlängerte Näschen, die winzigen schwarzen Perlen der Äuglein, die niedlichen Ohren, die Pfötchen, und das Fell so weich, ein Samthabitchen, wie es auf der ganzen Welt nicht seinesgleichen gibt. Und gar erst die Zähnchen:[136] köstlich diese winzigen Gebilde, 32 an Zahl, dolchspitz, scharfhöckerig; gleich den Schneiden der Schere passen sie aufeinander oben und unten, zum Zermalmen der harten Chitinpanzer, wie sie die Insekten tragen, geschaffen und zum Zerschneiden von Haut und Muskeln der kleinen Beutetiere geeignet.
Aber die Waffe allein tut's nicht, die Spitzmäuse verstehen sie auch zu führen, und eine Tapferkeit, ja Todesverachtung steckt in diesem Pygmäengeschlecht, daß kein Wesen sicher vor ihnen wäre, wenn sie eben nicht zu den kleinsten Warmblütern gehörten. Wehe, wenn sich ein anderes Tier in das Bereich der Kleinen verirrt! Jede Maus wird angefallen und bald überwunden. Kampf auf Leben und Tod! Pardon geben, das kennen die Spitzmäuse nicht, und der Sieger frißt den Besiegten. Ein paar Wollfleckchen bleiben übrig, vielleicht auch das Schwänzchen. Die Zähne vermögen selbst die stärksten Knochen der Maus zu zerknacken. Erbitterte Kämpfe auch unter den Artgenossen, sogar unter den nächsten Blutsverwandten. Die Mutter beißt ihr Kind tot, das sie entwöhnt hat, wenn's wieder zu ihr zurückkehrt, und frißt es mit Stumpf und Stiel – nun wird's das Wiederkommen vergessen; der Gatte frißt die Gattin, die Geliebte den Freier, der Bruder den Bruder. Keins fühlt sich sicher vor seinen Genossen; es kommt nur darauf an, wer der Stärkere ist. Gewalt geht vor Recht.
Auch ihre Wohnung hat sich die Spitzmaus meist mit Gewalt erobert, ein Mauseloch ist's. Der rechtmäßige Besitzer ist den Weg alles Fleisches gegangen und seine hoffnungsfrohe Kinderschar mit ihm. Oft genügt der Spitzmaus auch eine Höhlung im Wurzelgeflecht einer Buche, einer Eiche oder eine kleine Bodenvertiefung[137] zwischen allerlei Pflanzenwust zur Aufnahme ihres Wochenbetts. Ende Mai, Anfang Juni ist die Kinderstube voll jungen Lebens: fünf bis zehn winzige Dinger, nackt und unbeholfen, blind noch und zahnlos. Piepend und winselnd suchen sie nach dem Milchquell, wenn die Alte sich sorgsam über die rosigen Körperchen legt. Dann herrscht Ruhe am häuslichen Herd; nur das saugende Atmen vernimmt die glückliche Mutter, bis schließlich eins nach dem andern die Zitze freigibt. Nun sind sie gesättigt und schlafen, und die Mutter kann auf kurze Zeit ihre Kinder verlassen, um für die eigne Nahrung zu sorgen.
Nach vier Wochen schon wird sie von der kleinen Gesellschaft begleitet, meist gegen Abend, wenn die Sonne zur Rüste gegangen ist. Fürs helle Licht taugen die Äuglein nicht; da werden sie zugekniffen, daß sie vollständig im Samtfellchen verschwinden. Und selbst im Dunkel der Nacht folgen die Spitzmäuse gewiß nicht dem Auge, vielleicht auch nur selten dem Ohr; in dem Rüsselchen haben sie, was sie bedürfen, einen feinen Spürsinn und feinen Geruch, der Insekten und Würmer wittert und dem Jäger die geringsten Erschütterungen des Bodens verrät, die solch' kleine Beute verursacht. Die Spitzmäuse sind ausschließlich Fleischfresser; sie verhungern lieber, als daß sie irgendwelche Pflanzenkost anrühren. Und deshalb gehören sie für den Menschen zu den nützlichsten Tieren, zumal ihr Appetit außerordentlich groß ist. Hunger längere Zeit zu ertragen, wie etwa der Frosch es vermag, das ist einer Spitzmaus unmöglich. Wieviel Leben steckt aber auch in dem kleinen Warmblüter, mit dem Stumpfsinn des Lurchs nicht zu vergleichen!
Selbst im kalten Winter sind die Spitzmäuse munter und guter Dinge; von einem regelrechten Winterschlaf wollen sie nichts wissen. Ja ich habe die kleine Gesellschaft nie so lebhaft gefunden, wie gerade in der kalten Jahreszeit. Da kommen die Spitzmäuse gern von den Feldern und Waldrändern herein nach den Ställen und Schuppen der Landwirte, huschen nach Mäuseart überall herum und suchen, wie sie ihren Hunger stillen. Im verborgenen Winkel zwischen dem Gebälk schlummert so manche Insektenpuppe, und mancher Falter hat sich hier zur langen Winterruhe zurückgezogen; Spinnen gibt's auch überall, und wenn man Glück hat, läuft einem auch ein Mäuschen über den Weg – dann wehe dem kleinen Nager!
Die Spitzmäuse haben wenig Freunde unter den Menschen. »Mäuse« sind's, denkt der Bauer und schlägt sie tot oder zertritt sie roh mit dem Stiefel. Da sind Spitz und auch der alte erfahrene Kater weit klüger, als ihr Herr und dessen ganze Familie. Spitzmäuse und Mäuse können die beiden gar wohl unterscheiden. Freilich der Kater läßt sich auch täuschen, doch nur im ersten Augenblick; er fängt die Spitzmaus wie jedes Mäuslein und beißt sie tot – ein kurzer Aufschrei, dann ist alles vorbei. Aber statt die Beute zu fressen, läßt er sein Opfer unbeachtet liegen und wischt sich den Mund, als habe er etwas Unreines berührt. Und der Spitz? Er fährt wohl auch auf das samtige Tierchen los, aber er packt's nicht; denn der Moschusgeruch, den die Spitzmaus ausströmt, ist so stark, daß keine feine Hundenase dazu gehört, um zu erkennen, um wen sich's hier handelt. Einem anständigen Hund ist nichts widerlicher, als solch mit Moschusparfüm behaftetes Wildbret – pfui Pudel![139] denkt sich der Spitz. Selbst Fuchs, Iltis und Steinmarder mögen von der Spitzmaus nichts wissen, obgleich sie selbst doch auch nicht gerade nach Veilchen oder Maiglöckchen duften. Nur die gefiederten Mäusejäger, die Tagraubvögel, vor allem der Bussard, ebenso die nächtlichen Eulen sind nicht so empfindlich. Sie fragen nicht lange: ist's Spitz- oder Feldmaus? Mit ein paar Schnabelhieben wird die Beute getötet und zerteilt, oder sie schlucken das ganze Tierchen auf einmal hinunter, wie wir eine bittere Pille; da merkt man von dem Moschusgeruch und dem üblen Geschmack nur wenig.
Der Dritte im Bunde der Sippe ist ein ganz abenteuerlicher Gesell; er lebt unter der Erde, und nur in der Nacht erscheint er bisweilen an der Oberfläche: der Maulwurf. Ein Samtkleidchen hat er an, so fein und so weich wie die Spitzmaus. Das ganze Persönchen ist in dichten Pelz eingehüllt, an dem weder Nässe noch Erdkrümchen haften; nur die Pfoten, die Spitze des Rüssels und das letzte Ende des Schwänzchens schauen aus dem Samtfell hervor. Die Ohren liegen versteckt und ebenso die winzigen Äuglein. Der Plüschanzug kommt nie aus der Ordnung, mag sich sein Träger vor- oder rückwärts in dem dunklen Erdgang bewegen; denn es fehlt ihm der »Strich«, und nirgends zeigt sich ein »Wirbel«, wie sonst im Fell glatthaariger Tiere. Und wie schön ist die Färbung des Kleids, oft tiefschwarz mit fast metallischem Glanz, ins Stahlblau spiegelnd, oft bräunlich, bisweilen auch silbergrau oder gelblich; selbst weiße Maulwürfe finden sich, regelrechte[140] Albinos, wenn auch nur selten. Und weiter, die Unterseite ist selbst zwischen den Beinen ebenso dicht behaart wie der Rücken und ebenso dunkel gefärbt.
Heute zählt der Maulwurf gleich Marder und Hermelin mit zu den Pelztieren, eine Ehre, die Tausende schon mit dem Leben bezahlt haben. Aber wie klein sind die einzelnen Fellchen, eine mühsame Arbeit für den Kürschner! Doch die Leute bezahlen's, solange es die Mode gebietet. Und die Nachfrage nach diesem Pelzwerk war, wenigstens in den Jahren 1919 und 20, so stark, daß damals märchenhafte Preise gezahlt wurden – 20, ja 25 Mark für solch winziges, noch nicht einmal zugerichtetes Fellchen! Ich hätte das Gesicht unsers alten Tobias vom Rittergut sehen mögen, wenn er das gehört hätte; die Pfeife wäre seinem zahnlosen Munde entfallen, und wie ein Kettenhund hätte er geheult, daß ihm sein Lebtag der Verwalter nie mehr als 12 Pfennige für einen Maulwurf bezahlt hat. Der Alte verstand seine Kunst. In die Laufröhre, gleich neben dem aufgestoßenen Erdhaufen, senkte er die Drahtschlinge, befestigte ganz lose das hölzerne Häkchen daran, das bei der geringsten Berührung heraussprang, bohrte den biegsamen Stock tief in die Erde und zog ihn mit einem Strick zu der klug ersonnenen Falle herab. Nun geht dir's ans Leben, du unterirdischer Wühler! Stößt du mit deinen Schaufelhänden nur ein wenig an den hinterlistigen Haken, gleich wippt die Schlinge empor und erwürgt bist du, noch ehe der Galgen wieder zur Ruhe gekommen ist.
Als Kind habe ich oft dem Tobias in sein Handwerk gepfuscht und manche Falle zerstört; denn ich hatte es gelesen, was Bechstein und Lenz von dem Maulwurf erzählen, wie er ein gar nützliches Tier sei, da er Regenwürmer[141] und Engerlinge verzehre, und nur Dummheit sei's, wenn man ihn töte. Diese Dummheit hatte sich vor ein paar Jahren zum Wahnsinn gesteigert: Tagediebe lauerten auf Feldern und Wiesen dem unterirdischen Gesellen auf; ja es gab Landwirte, die solchen Maulwurfsfängern ihren Grund und Boden geradezu als Jagdrevier gegen ein schönes Sümmchen verpachteten. Glaubt der Bauer wirklich, daß dieser Judaslohn hinreicht, den Schaden quitt zu machen, den das Heer der Regenwürmer und der Insektenlarven, die nun ungestört ihr Handwerk treiben können, der jungen Saat zufügt! In mancher Gegend hat dieser Unfug schon dazu geführt, daß die Maulwürfe selten geworden, ja hie und da bereits verschwunden sind. Die Maulwurfshaufen, über die du dich oft so geärgert hast, bist du los, dummer Bauer, aber ebenso deine besten Bundesgenossen im Kampfe gegen das Ungeziefer, das nun überhand nimmt. Zum Glück beginnt man bereits einzusehen, wie töricht es ist, den Maulwurf zu vertreiben. In Bayern hat man ein Gesetz zum Schutze dieses Insektenfressers geschaffen; in Sachsen freilich ist eine gleiche Gesetzesvorlage unter den Tisch des Hauses gefallen, hauptsächlich deshalb, weil die Mode sich von dem Pelzwerk wieder abgewandt hat, die Fellchen infolgedessen im Preise außerordentlich gefallen sind und so der Anreiz zur Maulwurfsjagd nicht mehr besteht.
Auch der Nutzen des Maulwurfs wird von mancher Seite stark angezweifelt. Regenwürmer vertilgt er; Regenwürmer aber sind nützliche Tiere, die den Boden düngen, lockern und durchlüften. Gewiß, wo aber diese Würmer allzu zahlreich austreten, da richten sie doch recht merkbaren Schaden an der Saat an, indem sie die[142] jungen Pflänzchen massenhaft hinab in ihr unterirdisches Reich ziehen und dann von den verwesenden Stoffen leben. Aber der Maulwurf frißt nicht nur Regenwürmer, sondern er stellt auch den Engerlingen, diesen schlimmen Gesellen, nach. Er folgt ihnen selbst in ihre tiefer gelegenen Schlupfwinkel, wohin sie sich in der kalten Jahreszeit zurückziehen. Denn zu den Winterschläfern gehört der Maulwurf ebensowenig wie die Spitzmaus. Tag für Tag, selbst wenn bitterer Frost die oberste Schicht der Erde in Bann hält und der Bauer denkt, es ist draußen alles Leben erstorben, arbeitet der unterirdische Wühler unermüdlich zum Nutzen des Landmanns, der ihm seine verborgene Tätigkeit nur allzuoft mit Undank vergilt. Auch bei lang anhaltender Trockenheit im Sommer, wenn die Engerlinge und andre Insektenlarven sich tiefer in die Erde eingraben, verlegt der Maulwurf seine Jagdgründe dahin. Es wird behauptet, daß er für die Zeit der Not auch Nahrungsspeicher einrichte, wie weiland Joseph in Ägypten in den sieben fetten Jahren, gewissermaßen Regenwurmmagazine, eingebaut in die Wandungen seiner unterirdischen Gänge. Weil er aber tote Tiere nicht gern frißt, sondern allezeit frisches Fleisch haben will, so bringe er den Würmern nur einen Biß bei, der die Ganglienkette zerstöre, so daß sie nicht recht sterben und nicht recht leben, auf keinen Fall aber entfliehen können. Man will Hunderte von Würmern in ganzen Haufen beieinander gefunden haben, denen ihr Feind die vorderen Ringe des Körpers, namentlich den sog. »Kopflappen«, aufgerissen habe. Und vielleicht sei es weniger der Biß selbst, als der Speichel des Maulwurfs, der die Lähmung der Würmer verursache.
Das Nahrungsbedürfnis unseres Insektenfressers ist, wie das aller kleinen Warmblüter, außerordentlich groß, und deshalb kann sein Nutzen nach dieser Richtung hin nicht hoch genug angeschlagen werden. Außerdem durchlüften seine Gänge den Boden, was den Pflanzen zum Vorteil gereicht. Die Erdhaufen, die er auf den Wiesen aufwirft, wird man ihm leicht verzeihen können; mit dem Rechen läßt sich alles schnell in Ordnung bringen. Und wenn auch durch die unterirdischen Wühlereien ein paar Saatpflänzchen gelockert werden oder das Gras der Wiese über dem einen oder andern Reviergang des Insektenjägers nicht recht gedeihen will, weil die Wurzeln bloßgelegt sind, so wird das nicht viel bedeuten. Nur im Ziergarten kann man den Maulwurf nicht dulden; aber nach Falle und Galgen braucht man nicht gleich zu greifen. Es gibt andre Mittel, durch die er sich leicht vertreiben läßt. Mit Petroleum getränkte Lappen oder Heringsköpfe kann er nicht erriechen; parfümiert man seine Gänge damit, so vergrämt man den Maulwurf. Noch sicherer ist es, um kleine Blumenbeete Dornen oder Glassplitter ein bis zwei Fuß tief einzugraben; sein empfindlicher Rüssel ist ihm zu lieb, als daß er ihn sich an solchen Dingen verletzen ließ.
Die Wohnung des Maulwurfs, eine kesselförmige Höhlung, liegt etwa einen halben bis dreiviertel Meter unter der Erde, an einer Stelle zumeist, die schwer zugänglich ist, z. B. unter dem Schutz einer Mauer, eines Erdhaufens oder dichten Wurzelgeflechts. Mit Laub, Moos, Stroh ist die Höhle gepolstert; denn sie dient nicht nur zur Wohn-, sondern auch zur Schlaf- und bisweilen zur Wochenstube. Von dem Kessel aus erstrecken sich strahlenförmig nach allen Richtungen mehrere[144] Gänge, die meistens wieder untereinander durch einen Rundgang verbunden sind. Diese Gänge vereinigen sich in einiger Entfernung zu einer Laufröhre, die nach dem Jagdgebiet führt. Auch vom Boden des Kessels senkt sich ein Gang in die Tiefe, um jedoch bald wieder aufzusteigen und gleichfalls jene Laufröhre zu erreichen. Die Wände der Röhren sind sorgfältig und sauber geglättet; denn der Hohlraum wird hier weniger dadurch gewonnen, daß der Maulwurf Erde auf die Oberfläche befördert, sondern dadurch, daß er mit seinem walzenförmigen Körper den lockeren Boden zusammendrückt.
Die sog. Maulwurfshaufen sind in der Regel auf das Jagdgebiet beschränkt, das oftmals 60 oder 80 m vom Wohnkessel entfernt liegt. Dieses Revier durchwühlt der Maulwurf nach allen Richtungen hin gründlich. Täglich baut er neue Gänge, wobei er die Erdmassen mit Nacken und Hals an die Oberfläche befördert. Wenn er »aufstößt«, bleibt er aber in weiser Vorsicht immer noch etwas unter der Erde. Trotzdem wird er bei dieser Tätigkeit nicht selten von einem Feind überrascht und gepackt, vom Fox, der schnell seine Schnauze in die lockere Erde stößt, oder vom Storch, der mit dem Bajonettschnabel tief in den aufgeworfenen Haufen sticht. Auch der alte »Tobias« hat so manchem Maulwurf schon aufgelauert, wenn er gerade aufstößt, was dreimal am Tage, früh, mittags und abends, mit genauer Zeiteinteilung geschehen soll. Schnell das Grabscheit in die Erde stoßen und herauswerfen, was es gefaßt hat! Der überlistete Wühler fliegt mit in die Luft und ist dann verloren.
Wer noch nie junge Maulwürfe gesehen hat, der kann sich kaum eine Vorstellung davon machen, wie[145] spaßhaft diese winzigen Wesen aussehen. Sie sind, eben geboren, nicht viel größer als eine weiße Bohne, nackt, ganz unbehilflich, alle Glieder unfertig, Schweinsembryonen zu vergleichen. Dabei sind sie dick und wohlgenährt, rundlich, und die fein gefaltete Haut ist trotzdem auf Zuwachs der Leibesfülle berechnet. Nach zehn Tagen etwa sind die Körperchen mit zartem Flaum überzogen, durch den die rosige Haut aber noch immer durchschimmert, bis sich die Haare zu dem weichsten Samtfellchen schließen. Noch zwei Wochen vergehen, dann werden die Kleinen allmählich entwöhnt; Regenwürmer und allerlei Kerbtiere trägt die Mutter herbei und verfüttert sie stückweise an ihre Kinder. Droht eine Gefahr, so gräbt sie in Eile eine andere Höhle und trägt ihre Jungen im Maule dahin. Namentlich Hochwassergefahr, aber auch die Nachstellungen anderer Maulwürfe, den Vater nicht ausgenommen, veranlassen die Mutter zu solcher Fürsorge. Nach vieler Mühe sind die Jungen endlich so weit, daß sie der Alten auf ihren Pirschgängen folgen können, bis sich schließlich eins nach dem andern von der Familie trennt und nun ein selbständiges Leben beginnt. Noch ein zweites Mal wirft die Mutter vier oder fünf Junge, die aber erst im kommenden Frühjahr einen eigenen Hausstand gründen.
Es gibt kaum ein anderes Säugetier, dessen Körperbau sich den Verhältnissen, unter denen es lebt, so vollkommen angepaßt hat, wie der Maulwurf. Oder richtiger: beim Maulwurf läßt sich die Übereinstimmung des äußeren und inneren Baus mit der Lebensweise so deutlich erkennen, wie wohl bei keinem andern Säugetier. Zur unterirdischen Wühlarbeit hat die Natur den Maulwurf bestimmt, und nur unter diesem Gesichtspunkt[146] wird sein seltsamer Körperbau verständlich. Die Vorderfüße sind zu wirklichen Händen umgebildet worden mit fünf Fingern, an denen krallenartige Schaufelnägel sitzen. Sie stehen seitwärts am Körper, die Handfläche nach hinten, der kleine Finger nach oben gerichtet. Ihr Arbeitsradius reicht beiderseits so weit, daß der walzenförmige Leib des Tieres in dem gegrabenen Tunnel gerade Platz findet. Kräftig sind jene Schaufeln gebaut; ihr kurzer Stiel, den Ober- und Unterarm darstellend, ist ganz im Körper verborgen. Starke Muskeln treten von dem gekielten Brustbein an die Knochenwülste der Arme heran und vermitteln diesen die Kraft, die schwere Arbeit zu leisten. Die Hintergliedmaßen sind viel schwächer; sie haben den Körper nur vorwärts zu schieben und zeigen deshalb gewöhnliche Füße mit Zehen und Sohlen, wie sie auch Igel und Spitzmäuse besitzen. Auffallend stabartig gebildet sind Hüft- und Sitzbeine; sie legen sich der Wirbelsäule an und steifen sie, um das Vorwärtsschieben der lebendigen Bohrmaschine zu erleichtern.
Daß auch die winzigen Äuglein, nicht größer als ein Stecknadelkopf, zu dem unterirdischen Leben passen, liegt auf der Hand. Im Dunkel der Erde sind sie ganz überflüssig, und wenn auch der Maulwurf in der Nacht aus seiner Grube hervorkommt, so genügt es ihm wohl, hell und dunkel unterscheiden zu können. Mehr braucht er nicht; das Geruchsorgan und der feine Tastsinn seines Rüssels verraten ihm, was er zu wissen bedarf. Die Ohrmuscheln fehlen völlig. Sie würden als Fangtrichter für Erdkrümchen nur hinderlich sein; auch leitet der Boden die Schallwellen weit besser als Luft. Noch manche andere Anpassungen lassen sich auffinden: die[147] Halswirbel, die einander teilweise überdecken; es kommt ja nicht auf Beweglichkeit, sondern im Gegenteil auf eine gewisse Starrheit dieses Körperteils bei der Minierarbeit an; die Hautfalte der Oberlippe, die sich an die Unterlippe fest anlegt und den Mund vollkommen abschließt, daß auch den feinsten Erdteilchen der Eintritt gewehrt wird; eine Hautfalte an der Ohröffnung, die demselben Zweck dient usw.
Man wird zugeben, daß der Maulwurf in seiner ganzen Erscheinung ein besonders interessantes Tier unserer Heimat ist, dazu eins der nützlichsten Geschöpfe, zugleich aber auch ein volkstümliches Tier, von dem manche Fabel zu berichten weiß. Ich erinnere nur an den »Weißen Maulwurf« von Otto Julius Bierbaum, dem die Ehre ward, daß man ihn im Maulwurfs-Pantheon beisetzte, oder an den Maulwurf G. A. Bürgers, dem alle Tugend nichts half; der Gärtner schlug ihn tot, weil er die schön geebneten Blumenbeete durch seinen Aufwurf verunziert hatte.
Kurzsichtig, töricht und vor allem undankbar ist der Mensch. Wieviel Feinde haben doch gerade die nützlichsten Tiere! Igel, Spitzmaus, Maulwurf, ein Kleeblatt, an dem jeder seine Freude haben sollte! Ich möchte all meinen Lesern die Samtfellchen Maulwurf und Spitzmaus, ganz besonders aber auch meinen Liebling, den stachelborstigen Igel, recht fest an das tierfreundliche Herz drücken. Möge nie die Zeit kommen, wo eins von diesen Dreien durch Unverstand und Roheit aus unsrer Heimat verdrängt sein sollte!
Von jeher hat die Bautätigkeit der Tiere die Aufmerksamkeit des Menschen in hohem Grade auf sich gelenkt. Besonders zwei Tiergruppen sind es, die Insekten und die Vögel, denen wir in dieser Beziehung die höchste Bewunderung zollen müssen. Während aber bei jenen nur eine verhältnismäßig geringe Zahl sich durch allerdings staunenswerte Baukunst auszeichnet, verstehen es die meisten Vögel mehr oder weniger kunstvolle Nester zu errichten. Grundverschieden sind diese nach Bauart, Form und Material; ja sogar der einzelne Vogel derselben Art baut bisweilen ganz abweichend – bald frei in luftige Höhe, bald auf den Boden, bald ins Dunkel einer Höhle – immer aber versteht er es, sein Nest in vollendeter Weise der Umgebung wie seinen Bedürfnissen anzupassen, so daß jeder Architekt von dem kleinen Vogel lernen könnte.
In der freien Natur gibt es wohl keinen Platz, der diesem oder jenem Vogel nicht willkommen wäre, keine Örtlichkeit, die nicht Zeuge des lieblichsten Familienlebens werden könnte. Unsre kleinen Sänger vertrauen ihre niedlichen Nester dem Zweigwerk von Baum und Strauch an; sie schlüpfen durch ein Astloch des Obstbaums oder stellen ihr Nest ins Gestrüpp und dürre Laub auf den Boden. Raubvögel bauen meist auf Felsen und hohen Bäumen; sie sind stark genug, freistehende Horste verteidigen[149] zu können. Auch andere große Vögel verhalten sich ähnlich: Reiher, Störche, selbst Raben, Krähen und Elstern. Die Rebhühner, Trappen, Lerchen und andere Feldbewohner brüten am Boden; die Spechte, diese echtesten Baumvögel, meißeln sich eine Höhle in den Baumstamm, die später auch von andern Höhlenbrütern benutzt wird. Die Sumpfvögel bauen auf den Boden am Rande des Wassers, die Wasservögel ins Röhricht von Fluß und See; die Lappentaucher errichten nicht selten ein freischwimmendes Nest. Strandvögel vertrauen Eier und Brut dem flachen Kies oder der steilen Klippe an, wo die Woge brandet. Die lichtscheuen Eulen brüten an dunklen Orten, in Fels- und Mauerspalten, in Baumhöhlen; der winzige Zaunkönig wählt für sein kugliges Nestchen irgendeinen der tausend Schlupfwinkel seines Reviers, ein Wurzelgeflecht, das Mauerloch einer Brücke, Lücken in einer Waldhütte, einer Holzklafter usw.
Aber es gibt auch Ausnahmen, die wir Menschen uns nicht so einfach zusammenreimen können. So brüten Rohr- und Kornweihe, diese fluggewandten Räuber, auf dem Boden; der Fischer Kormoran errichtet seinen ungefügen Bau auf hohen Bäumen, nicht selten auch manche Wildentenart; so brütet die Schellente bei uns mit Vorliebe in Asthöhlen, oft recht hoch über dem Boden, und die Stockente hat sich schon Elsternhorste als Kinderstube gewählt. Der weiße Storch sucht den Schutz des Menschen auf, desgleichen die Haus- und die Rauchschwalbe, während deren Base, die Uferschwalbe, obwohl sie im übrigen ähnliche Lebensweise führt, in steile Lehm- und Erdwände Röhren gräbt, einen Meter tief und darüber. Wer würde es dem farbenprächtigen Eisvogel ansehen, daß er gleichfalls ins unterirdische Dunkel eines selbstgegrabenen[150] Stollens schlüpft, um seine Jungen zu ätzen, wer der Hohltaube, daß sie ihr Zwillingspärchen in einem Astloch aufzieht oder in einer verlassenen Spechtshöhle, während doch Ringel- und Turteltaube freistehende Nester bauen! Warum errichtet der Gartenlaubvogel die Wiege seiner Jungen in der Astgabel niedriger Bäume, alle andern Laubvögel aber am Boden oder unmittelbar darüber, in der Vertiefung eines alten Baumstocks u. dgl.? Warum dort ein offenes Nest, hier aber ein kugelförmiges mit engem Eingang, geformt wie ein Backofen? Ja, wer es wüßte!
Strenger noch als an einer bestimmten Örtlichkeit hält jeder Vogel an der Wahl gewisser Niststoffe fest. Kein Goldammer verzichtet auf Pferdehaare oder Schweinsborsten; keine Entenart brütet die Eier aus, ohne mit zartem Flaum das Innere des Nestes auszupolstern. Krähen und Elstern tragen Erde und kleine Rasenstücke in ihren Horst; Amsel und Ziemer verbinden die eigentlichen Niststoffe mit Lehm und mit feuchter Erde, wodurch das unförmliche Nest oft außerordentlich schwer wird, während ihre Verwandte, die Singdrossel, fein zerkleinerten Holzmull, den sie mit Speichel vermischt, gleichmäßig und glatt über die Innenwand ihres saubern Baues streicht. Feuchte Erdklümpchen benutzt die Hausschwalbe, zartes Moos der Zaunkönig; dürres Laub bildet die Grundlage für das Nest der Nachtigall; Flechten und Insektengespinst verwenden Buchfink und Goldhähnchen – kurz, jeder Vogel hat eine ausgesprochene Vorliebe für ganz bestimmte Stoffe, und nur im Notfall einmal wird er sie durch ähnliche Dinge ersetzen.
Wie sich die besondere Nistweise, an der die einzelne Art mehr oder weniger festhält, bis zu der gegenwärtigen[151] Musterform entwickelt hat, ist eine offene Frage. Wir wissen nicht einmal, sind die bodenständigen Nester oder die in den Zweigen der Bäume erbauten als die ursprünglicheren anzusehen; nimmt der Vogel, der in Höhlen brütet, eine tiefere Stufe ein als der sogenannte Freibrüter, oder lassen uns nicht gerade viele Höhlenbewohner, die ihr oft recht hübsch gebautes Nestchen in ein Astloch, eine Mauerspalte stellen, vermuten, daß sie ehemals Freibrüter waren, aber um die Sicherheit für Eier und Junge zu erhöhen, zu dieser vollkommeneren Methode fortgeschritten sind? Wenn wir im folgenden einige besonders eigenartige Vogelbrutstätten betrachten wollen, und zwar in der Anordnung, daß wir von den scheinbar einfachsten Verhältnissen ausgehen und uns zu immer kunstvollerer Bauweise wenden, so möchten wir doch keineswegs damit behaupten, daß dieser Gang nun auch wirklich der natürlichen Entwicklung der bei den Vögeln geübten Baukunst entspreche.
Einzelne Vögel begnügen sich mit der einfachen Reptilienmethode, indem sie ohne weitere Fürsorge ihre Eier auf den Boden legen. So vertrauen die meisten Strandläufer, viele Schnepfenvögel, Seeschwalben, manche Möwen die Eier dem bloßen Kies an oder der kurzen Grasnarbe, ohne daran zu denken, ein wirkliches Nest zu bauen. Auch die Nachtschwalbe kennt ein solches nicht; auf plattem Boden brütet sie ihre beiden Eier aus, oder auf dichtem Heidekrautgestrüpp, auf dem Moos eines niedrigen Baumstocks u. dgl.
Bei sehr vielen Höhlenbrütern kann man gleichfalls nicht von wirklichem Nestbau reden; sie begnügen sich damit, die Eier ohne besondere Unterlage einem Mauerloch, einer Felsenspalte oder einer Baumhöhle anzuvertrauen.[152] Die natürliche Hohlform hält Eier und Wärme zusammen; ein wenig Erde oder Holzmull findet sich fast in jedem solchen Raume, wodurch den Eiern wenigstens ein leidlich weiches Lager wird, und der Schutz für den brütenden Vogel wie für die Brut ist doch ungleich höher hier in der dunklen Höhle als draußen im Freien. Spechte, der Wendehals, manche Eulen, die Hohltauben, der Wiedehopf u. v. a. brüten in dieser Art, die indessen nur einen kleinen Fortschritt bedeutet im Vergleich mit der einfachen Nistweise der Nachtschwalbe. Natürliche Bodenvertiefungen, die dem Körper des Vogels mehr oder weniger angepaßt waren, Verstecke im Pflanzengestrüpp und ausgefaulte Löcher im Baumstumpf mögen die Verbindungsglieder gewesen sein.
Etwas mehr Sorgfalt zeigen unsre Rebhühner, Trappen, manche Seeschwalben, Möwen, Rallen u. v. a. Sie scharren eine seichte Vertiefung in den Boden, knicken Stengel und Halme um oder bilden durch häufiges Drehen des Körpers eine geeignete Stelle, die sie nun mit ein paar trocknen Gräsern oberflächlich ein wenig auspolstern. Wozu sollten auch die Jungen, z. B. die des Rebhuhns, eines künstlichen warmen Nestes bedürfen? Sobald die Eihülle gesprengt und der Flaum getrocknet ist, laufen sie ja doch davon, um vielleicht nie wieder an den Ort zurückzukehren, wo sie das Licht der Welt erblickt haben. Vögel, deren Junge längere Zeit im Neste verbleiben, sogenannte »Nesthocker«, verwenden stets mehr Fleiß auf die Niststelle; doch verdient diese bei vielen, die auf dem Boden oder in Höhlen brüten, noch kaum den Namen eines eigentlichen Nestes. Die Feldlerchen z. B. suchen sich eine kleine Vertiefung zwischen Erdschollen oder im Grase, erweitern und runden[153] sie nach Bedarf und tragen nun Stoppeln, Halme, zarte Wurzeln zusammen. Mit ihrem Körper formen sie alles zu einem tiefen Napf, den sie schließlich noch mit einzelnen Pferdehaaren u. dgl. auspolstern. Unsre niedlichen Blaumeisen begnügen sich, falls die Höhle, die sie gewählt haben, sehr eng ist, mit einem recht einfachen Bau: feine Brocken faulenden Holzes, darüber ein paar Federn und Haare, das ist alles. In weiten Hohlräumen aber sorgen sie für eine dichte Unterlage und für ein weiches Haar- und Federpolster. Ähnlich verhalten sich auch die andern Meisen mit Ausnahme der Schwanzmeisen.
Einen Fortschritt zeigen schon die sogenannten »Halbhöhlenbrüter«, welche für die Wiege ihrer Jungen irgendeinen Winkel wählen, wie Hausrotschwanz, grauer Fliegenschnäpper, weiße Bachstelze u. a.; auch das Rotkehlchen gehört hierher, das sich ein Versteck in einem ausgefaulten Baumstumpf, zwischen Wurzelgeflecht, eine weite Erdhöhle u. dgl. aussucht. Sein Nest stellt ein lockeres, kunstloses Gewebe dar, meist auf einer Grundlage dürren Laubes. Beim Hausrotschwänzchen kann man es genau beobachten, um wieviel vollkommener der Vogel baut, wenn er das Nest auf einen freien, nur von oben geschützten Balkenkopf oder hinter einen Dachsparren stellt, als wenn er sich ins Halbdunkel einer Höhle zurückzieht. Hier nur eine ungeordnete Anhäufung von Niststoffen, dort aber ein dichtes Gewebe mit sorgfältig gepolsterter Aushöhlung eines zierlichen Napfes.
Wirkliche Kunstbauten finden wir jedoch erst bei den sogenannten Freibrütern, und zwar besonders bei denjenigen, die sich losgemacht haben von der Scholle des[154] Bodens und im Astwerk von Baum und Strauch oder am Schilfhalm ein lustiges Nest bauen. Doch dürfen wir auch manchen Höhlenbrütern, wie den Baumläufern, dem Star, Gartenrotschwanz, Trauerfliegenfänger, eine gewisse Fertigkeit nicht absprechen. Nach unsrer Meinung stellten diese Vögel, wie wir schon angedeutet haben, ehemals freistehende Nester her; die seit alters geübte Bauweise pflegen sie aber auch heute noch weiter, trotz der veränderten Verhältnisse, nur daß sie dabei weniger sorgfältig verfahren. Man vergleiche z. B. das Nest der Spechtmeise, die sich ein Astloch erwählt, mit dem Bau der freibrütenden Schwanzmeise, einem der kleinsten Vögelchen unsrer Heimat. Bei jener eine schlechte Unterlage aus lockern Stückchen von Buchen- und Eichenblättern oder ein Wulst dünner Schalen der Kiefernrinde; das Nest der Schwanzmeise dagegen ein Kunstbau, kugelförmig, mit einem Schlupfloch, zusammengefilzt aus Astmoosen, Baumflechten, Birkenschalen, Schuppen der Eichenrinde und Haaren, überkleidet mit Spinnen- und Raupengespinst, innen aber ausgefüttert mit Federn und Wolle. Überhaupt zeichnen sich die kleinsten der kleinen Baumeister durch höchste Kunstfertigkeit aus. Hoch in die herabhängenden Zweigenden einer Fichte oder Tanne hat das winzige Goldhähnchen sein beinahe kugelförmiges Nestchen aufgehängt. In die ziemlich glatte Außenwand sind die Spitzen der dünnen Triebe des Nadelbaums geschickt eingeflochten, daß der kleine Bau frei in der Luft schwebt; oben führt eine enge Öffnung ins Innere, das mit wärmenden Federchen dicht ausgekleidet ist. Oder das Nest des Zaunkönigs: außen nicht selten ein wüster Haufen von Stengeln, Wurzeln und Blättern, innen aber eine[155] dicht gefilzte Lage von grünem Moos, auf welche schließlich das weiche Federpolster folgt.
Auch die Finkenvögel bauen sehr hübsche Nester, an erster Stelle unser frohschmetternder Buchfink. Hier steht ein solches auf dem hohen Stumpf eines Fliederstrauchs, dessen Fortsetzung es nach Stellung und Form zu bilden scheint; aufs peinlichste ist es mit Lebermoosen überzogen, wie sie der Stamm trägt, und mit kleinen braunen Rindenstückchen beklebt, wie sie am Boden liegen. Dadurch, daß der Vogel die Niststoffe aus der Umgebung nimmt, paßt er das Nest dieser gewöhnlich aufs schönste an, wodurch die Sicherheit erhöht wird. Ob dabei bisweilen auch kluge Berechnung eine Rolle spielt, möchte ich nicht entscheiden. Ich habe Finkennester gefunden, in deren Wand Fetzen weißen Papiers sehr geschickt eingewebt waren – sie standen auf weißstämmigen Birken –, ein Nest des Zaunkönigs, das durch Verwendung grauen Mooses und grauer Algen die Farbe der granitenen Brücke täuschend nachahmte, unter die es gebaut war, und ein andres, dessen grüner Moosüberzug mit dem Grün seiner Umgebung vollkommen übereinstimmte. Vielleicht ist es so, daß der Vogel durch einen auffallenden Farbengegensatz des Nestes mit dessen Umgebung unangenehm berührt wird und ohne viel Nachdenken die Stoffe wählt, die in der Farbe zu der unmittelbaren Nachbarschaft des Nestes passen. Ich entsinne mich aber auch einiger Nester, wo von solcher Übereinstimmung nicht die Rede sein konnte; so hatte ein Schwanzmeisenpärchen ein ganz lichtes, aus heller Baumrinde und Laubmoosen gefilztes Nest in das dunkle Grün einer Jungfichte gestellt, daß es weithin erkennbar war.
Ein sehr zierliches Nest bauen auch die Rohrsänger. Von ein paar Schilfstengeln, die in die Wandungen eingewebt sind, wird der kegelförmige Bau getragen, die Spitze nach unten. Gespaltene Schilfblätter, schmales Gras und biegsame Halme bilden die kunstvoll geflochtene Wandung, in der jede Lücke mit Pflanzenwolle verstopft ist, namentlich von der Weide. An allen Bewegungen der Halme nimmt der luftige Bau teil, wenn der Wind durchs Schilf saust und die Spitzen hinabbiegt bis in die Wellen des Teichs; aber der Napf ist so tief, daß die Eier so leicht nicht herausfallen.
Freilich gibt es auch unter unsern kleinen Sängern einige, die recht liederlich bauen. Das gilt z. B. von unsern Grasmücken. Ich habe Nester der kleinen Zaungrasmücke gefunden, deren Boden so locker gewebt war, daß man kaum begreift, wie sie die Wärme zusammenhalten können. Noch weniger dicht sind die sehr flachen Nester der Ringeltaube gebaut; nicht selten sieht man die weißen Eier zwischen den Lücken hindurchleuchten. Ja, es kommt vor, daß sie unter dem brütenden Vogel durch den Boden fallen, so daß ich glaube, die Ringeltaube ist erst nachträglich zum Freibrüter geworden, während sie früher, wie Hohl- und Felsentaube noch heute, in Höhlungen brütete.
Gleich der Ringeltaube verwenden fast alle größeren Vögel stärkere oder dünnere Reiser für die äußere Wandung, wie dies das Nest des Eichelhähers zeigt, oder die kleinen Horste der Elstern und Krähen und die bisweilen gar gewaltigen Reisighaufen, welche Raubvögel, Reiher und Störche zusammenschleppen. Solch ein Adlerhorst, ich denke an den eines Fischadlers, der auf dem vertrockneten Wipfel einer uralten Eiche stand, ist einer mächtigen[157] Stammburg zu vergleichen. Nicht das Paar, das jetzt droben haust, hat den riesigen, fast mannshohen Bau gegründet, sondern vielleicht seine Großeltern vor vielen Jahren. In jedem Frühling wird das Schloß der Väter von neuem bezogen und mit frischen Baustoffen belegt und ausgebessert; in seinen untern Schichten, gewissermaßen in den Kellerwohnungen, haben sich ein paar Meisen häuslich niedergelassen, wie ja auch in der Wandung alter Storchnester, die gleichfalls alljährlich von unsern Hausfreunden wieder bezogen werden, nicht selten Meister Spatz seine zahlreiche Nachkommenschaft großzieht. Verlassene Raubvogel- und Krähenhorste dienen übrigens manchen Vögeln zur willkommenen Wohnung; am häufigsten scheinen Waldohreule und Turmfalke von solch herrenlosem Eigentum Besitz zu nehmen.
Zu den hübschesten Nestern unsrer Heimat gehört das des gelbschwarzen Pfingstvogels, des Pirols. Freischwebend hängt es, einem Klingelbeutel vergleichbar, zwischen den Enden einer Astgabel; aus Bast, Halmen, Wollfäden, Oberhäutchen der Birkenrinde, feinen Hobelspänen u. dgl. ist es gar zierlich gewoben. Man begreift nicht, wie es dem Schnabel im Verein mit den Zehen möglich ist, aus dünnen Fasern solch feines, braungelbliches Gewebe herzustellen.
Von den Zimmerleuten unsrer Wälder, den Spechten, war schon die Rede; auch der Wendehals und manche Meisenarten verstehen sich auf dies Handwerk, insofern sie vorhandene Höhlen nach ihrem Bedürfnis vergrößern. Ähnlich ist die Tätigkeit der Minierarbeiter; nur haben es diese nicht mit Holz, sondern mit Lehm, Sand oder Erde zu tun, wie die Uferschwalbe, der Eisvogel[158] und der ebenso farbenprächtige Bienenfresser, der freilich unsrer Heimat fehlt, den ich aber an manchen Gewässern Südungarns beobachten konnte.
Mit Lehm und mit Erde arbeiten ferner die Maurer, zu denen unsre Schwälbchen gehören. Unterhaltend ist es, den emsigen Tierchen zuzuschauen. Zuerst werden feuchte Klümpchen – meist ist es Straßenkot – eins neben das andre in flachem Bogen an die Baustelle geklebt; dann ruht die Arbeit bis zum nächsten Morgen. Ist jetzt das Mauerwerk völlig trocken, so wird eine zweite Lage von Erdklümpchen so angesetzt, daß sie die erste Schicht überragt; am dritten Morgen wird in gleicher Weise fortgefahren. Schon geht die Arbeit leichter von statten, denn die Vögelchen brauchen sich nicht mehr an der Hauswand anzuklammern, sondern können auf dem bereits gemauerten fingerbreiten Rand Fuß fassen. Schicht folgt auf Schicht, wobei auch einige Halme, Borsten, Haare mit eingeklebt werden. Nach zwei Wochen etwa ist das kugelrunde Nestchen der Hausschwalbe oder das halbkugelförmige der Rauchschwalbe fertig; es bedarf nur noch der Auspolsterung mit Federn und Haaren.
Auch die Spechtmeise versteht sich auf Mörtel und Kitt; ist das Eingangsloch zur Baumhöhle, in der sie ihr kunstloses Nest erbaut, zu weit, so vermauert sie es ringsum mit eingespeichelten Lehmklümpchen, daß dem Eichhörnchen und andern Räubern der Zugang gewehrt wird.
Im allgemeinen beteiligen sich Männchen und Weibchen am Nestbau; sehr oft beschränkt sich aber die Tätigkeit des Männchens auf das Aufsuchen und Herbeitragen der Niststoffe, während das Weibchen gewöhnlich[159] die eigentliche Künstlerin ist. Wer beispielsweise den Pirol oder den Buchfink, bei denen sich die Geschlechter leicht unterscheiden lassen, belauscht, wie Männchen und Weibchen gemeinsam das Nest bauen, wird diese Verteilung der Arbeit bestätigen können.
Das Nest ist für den Vogel weit weniger ein Wohnhaus, als man gewöhnlich annimmt; zunächst dient es nur den Zwecken der Fortpflanzung, und bloß gelegentlich benutzt es das Elternpaar, bei ungünstiger Witterung darin Schutz zu finden. Auch die Nacht verbringt der Vogel, abgesehen vom brütenden oder die Jungen wärmenden Weibchen, meist nur in der Nähe der Niststelle. Manche bauen sich auch besondere Schlafnester, so der Zaunkönig; andere wieder sog. Spielnester, indem sie, wie die Grasmücken, hier und da mit dem Nestbau beginnen, ihn aber bald wieder einstellen, um an anderer Stelle von neuem zu probieren. Namentlich die Männchen können es im Frühjahr oft gar nicht erwarten, daß ihr Weibchen nun endlich mit dem Nestbau Ernst mache, und sie tragen deshalb allerlei Baustoffe ins Gezweig, um die Gattin aufzufordern: nun ist es Zeit.
Nicht genug staunen kann man über die peinliche Reinlichkeit der meisten Nester – »ein schlechter Vogel, der sein Nest beschmutzt«. Den Kot der Jungen tragen die Höhlenbrüter im Schnabel fort, und bei den Freibrütern – ich denke an Schwalben, Störche u. a. – lernen es die Kleinen sehr bald, ihre Kehrseite so zu wenden, daß der Kot über den Nestrand befördert wird.
Das ganze Leben und Treiben unsrer kleinen Sänger spielt sich während ihres kurzen Aufenthalts in der nördlichen Heimat am Nest und in dessen nächster Umgebung[160] ab, bis der große Tag kommt, wo das Vöglein seine Schwingen erhebt, um dem fernen Süden zuzueilen. Nur einen einzigen Vogel beherbergt unser Vaterland, der sich weder um Nestbau noch um Aufzucht der Brut kümmert, das ist der Kuckuck; von ihm gilt das lustige Sprüchlein:
Eigentlich war's zu einem ornithologischen Ausflug nach unserm sächsischen »Tausendseen-Land« noch ein wenig früh im Jahre. Doch was half's! Ich kann nicht verlangen, daß das Osterfest mit seinen Ferien bloß meinetwegen um einige Wochen verschoben wird. Und im vorigen Jahre konnte ich mich – genau wie 1911 – wenigstens einigermaßen mit dem Ostertermin aussöhnen. Der 16. April ist doch ein ziemlich später Zeitpunkt für das Fest, und da ich mich erst am »dritten Feiertag« (18. April) auf den Weg machte, durfte ich hoffen, wenn auch bei weitem noch nicht die volle Entfaltung des Vogellebens in jenem Gebiet, so doch immer schon den vielversprechenden Anfang dazu anzutreffen.
Es war also Aussicht vorhanden, daß ich von Dresden her ganz gleichzeitig mit dem oder jenem Bekannten, der aus Kleinasien, Ägypten, von den Ägäischen Inseln usw. in diesen Tagen heimzukehren pflegt, in Baselitz, Milstrich, Königswartha oder Commerau eintreffen würde. Mit Freund Langbein, dem Storch, klappte es auf die Minute, als ob wir uns verabredet hätten. Freilich mancher gefiederte Nachzügler fehlte noch; aber das schadete schließlich nicht viel. Der Vogelfreund sieht doch auch die, die nicht da sind, und interessiert sich auch dafür, welcher Vogel einer Gegend noch fehlt, sei es, daß er regelmäßig recht spät kommt, oder daß er sich gegen[162] seine Gewohnheit verzögert hat. Den rotrückigen Würger, den Mauersegler, die Nachtschwalbe, den Gartenlaubsänger, den Pirol, die Wachtel und namentlich die Rohrsänger konnte ich natürlich noch nicht erwarten.
Trotz dieser und anderer Lücken war es mir möglich, 71 Vogelarten in meine »unblutige Schußliste« einzutragen.
Der etwas einförmige Weg von Kamenz über Jesau nach Deutsch-Baselitz bot nichts Besonderes. In großer Menge saßen die Stare auf Wiesen und Feldern. Der Gesang der Lerchen erfüllte die Luft; Buchfinken schmetterten; Kohlmeisen ließen in jedem Obstgarten ihre hellen Glöckchenstimmen erklingen; Goldammern gaben mir ab und zu das Geleit, während ihre plumperen Vettern, die Grauammern, von den Straßenbäumen herab mit unermüdlicher Ausdauer ihr wenig musikalisches »zick zick zick schnirrrrps« zirpten. Haus- und Feldsperlinge natürlich in ausreichender Menge; ein Elsternhorst auf einer hohen Erle; aus der Ferne der durchdringende Ruf des Grünspechts; einige Nebelkrähen, schwerfälligen Flugs meinen Weg kreuzend, und – eine besondere Überraschung, daß er schon da ist – ein Gartenammer oder, wie er gewöhnlich heißt, ein »Ortolan«. Er saß an der Straße auf einem Baum, ließ sich aber nicht hören.
Deutsch-Baselitz liegt an dem größten stehenden Gewässer Sachsens, umfaßt doch der »Großteich« etwa 400 sächs. Scheffel, das sind mehr als 110 Hektar. In der Nähe noch einige kleinere Teiche, die alle der sehr ergiebigen Karpfen- und Schleienzucht dienen. Der Pächter des Guts war so freundlich, mir ein Boot zur Verfügung zu stellen und einen Fährmann zugleich. Noch[163] ehe man die weite Wasserfläche sieht, hört man bereits die hellen Lockrufe der Bläßhühner, das tiefe »grök grök« der Haubentaucher, das Grunzen und scharfe Lärmen der Rothälse, die garstigen Schreie auffliegender Stockerpel und die wohlklingenden Stimmen kleiner Krikenten. Einzelne Kiebitze gaukelten unruhig umher, taumelnden Flugs, und weiße Lachmöwen tummelten sich hoch in den Lüften.
Wir durchschreiten das abgestorbene Röhricht, um das Boot zu erreichen. Da fesselt ein grünfüßiges Teichhühnchen meine Aufmerksamkeit. In prachtvoller Balzstellung trippelt es am Ufer vor seinem Weibchen gar zierlich hin und her. Überraschend groß erscheint der Vogel in dieser verliebten Haltung. Den Schwanz hat er emporgerichtet, daß sich dessen schneeweiße Unterseite wirkungsvoll von dem übrigen dunkeln Gefieder abhebt. Die rote Stirnplatte und der hochgelbe Schnabel leuchten wie grellfarbige Blumen aus dem welken Schilf, und dieselben Farben wiederholen die koketten Strumpfbänder, die der Vogel an den Fersengelenken trägt. Jetzt läßt sich das Paar ins Wasser gleiten; auch hier wird das Männchen nicht müde, seiner Angebeteten den Hof zu machen. In zierlichen Bogen umschwimmt es sie, bald den weißen Federstrauß des Schwanzes, bald die feurige Pelargonie an der Stirnplatte ihr zukehrend – aber plötzlich sind die beiden verschwunden. Sie haben es wohl gemerkt, daß ich ihrem Liebesspiel gelauscht, und sind nun untergetaucht, sich mit ihren langen Zehen im Schilf unter dem Wasser festhaltend.
Wir betreten das Boot und fahren ein Stück hinaus auf die Fläche. Hunderte von Wasservögeln sind hier[164] vereinigt. In kleineren und größeren Trupps, auch nur in einzelnen Paaren schwimmen Bläßhühner und Enten aller Art, Taucher und Möwen. Oft verschwinden ganze Gruppen wie auf Kommando unter die Wasserfläche, während andere wieder auftauchen.
Es erfordert einige Mühe, in das Durcheinander der schwimmenden, tauchenden, niedrig über dem Wasserspiegel und hoch in den Lüften fliegenden Arten Ordnung zu bringen.
Die Bläßhühner freilich bieten keine Schwierigkeit; sie sind sofort zu erkennen: hühnerartig plump ihre Gestalt, das ganze Gefieder tiefschwarz bis auf die kreideweiße, weithinleuchtende Stirnplatte. Unruhig sind sie und recht laut; denn eifersüchtige Kämpfe werden jetzt fast beständig unter ihnen ausgefochten. Mit gesenkten Köpfen rudern die Nebenbuhler aufeinander los und prallen heftig schreiend zusammen, oder sie jagen sich, die Wasserfläche mit ihren Lappenfüßen schlagend, über den halben Teich hin, um sich dann schließlich schwerfällig in die Luft zu erheben oder im Schilfwald einzufallen.
Unter den Enten sind die zierlichen Tafelenten die häufigsten; mein Bootsführer, auch andere Leute in der Lausitz nennen sie »Brandenten«, was aber falsch ist. Sie zeigen wenig Scheu, erheben sich beim Nahen unseres Nachens immer zuletzt oder vertrauen auf ihre Fertigkeit im Tauchen. Dreifarbig ist das Kleid des Männchens: rostbraun Kopf und Hals, zartes Grau auf Flügeln und Rumpf; Brust und Hinterteil aber tiefschwarz. Mit etwas eingezogenem Hals schwimmen sie friedlich in großen Trupps umher, kein eifersüchtiges Gezänk, nur zärtlich pfeifende Laute, tauchen gemeinschaftlich,[165] oder es umschwärmen auch ein paar Männchen ein einzelnes Weibchen, diesem immer getreulich folgend, wohin es den Weg nimmt.
Auch die kleinen Krikenten sind in großen Scharen vertreten. Das Gefieder des Erpels ist graugewellt; der dunkelbraune Kopf zeigt einen grünglänzenden Streifen, der sich bis zur Hälfte des Halses herabzieht, aber selbst mit dem Feldstecher aus größerer Entfernung schwerer zu erkennen ist, als der metallisch-grüne und schwarze, weiß eingesäumte Spiegel an den Flügeln. Die Weibchen sind unscheinbar graubraun; doch tragen auch sie, gewissermaßen als Familienwappen, jene Flügelzier. Die kleinsten sind immer die beweglichsten und geschäftigsten. Leicht wie eine Feder erheben sie sich von der Wasserfläche, umkreisen in leichtem Flug den Teich, wobei wir, sobald sie sich uns nähern, deutlich ihre eigentümlich schwingenden Flugtöne vernehmen, und fallen dann wieder in einer seichten Bucht ein, um hier zu gründeln, wobei, wie bei unsern Hausenten, der hintere Körperteil senkrecht aus dem Wasser emporragt; denn ganz unterzutauchen ist nicht ihre Art.
Bedeutend größer als Tafel- und Krikenten sind die Stock- oder Märzenten, die Stammeltern unsres zahmen Hofgeflügels. Sie sind bereits mit dem Nestbau beschäftigt, schwimmen zu Paaren umher oder erheben sich paarweise in die Lüfte, wobei das galante Männchen stets dem Weibchen den Vortritt läßt. Der Stockerpel ist ein prächtiges Tier. Das metallische Grün von Kopf und Oberhals wird durch einen schneeweißen Ring von dem Braun des Unterhalses und der Brust scharf getrennt, und der violett-blau-grüne Spiegel ist gleichfalls ein hübscher Schmuck. Es gibt viele unter unsern Hausenten,[166] die sich Form und Farbe der Federn genau so schön erhalten haben, wie wir's an den wilden »Stocken« bewundern.
Auch die sog. Mittelente bewohnt die weite Fläche des Teiches, wenigstens in einigen Paaren. Aus der Entfernung gesehen, erscheinen diese Enten anspruchslos grau, das Männchen mit einem schwarzen, das mehr bräunliche Weibchen mit einem gelbroten Schnabel.
Viel auffallender sind die Schellenten wegen ihres scheckigen Kleides. Zwei große Felder auf den Flügeln, ebenso Brust und Hals, auch ein Fleck an der Wange hinter dem Schnabel leuchten schneeweiß, während der Rücken tiefschwarz gefärbt ist. Ich habe Schellenten, allerdings nie in besonders hoher Zahl, auf fast allen größeren Teichen der Lausitz gesehen; sie sind, obgleich ihre eigentliche Heimat weiter im Nordosten gelegen ist, für unser Sachsen seit einiger Zeit in recht erfreulicher Zunahme begriffen, und das ist um so verwunderlicher, als sich diese kleinen Enten mit Vorliebe Baumhöhlen, die doch immer seltener werden, zur Brutstätte auswählen. Mir ward von meinem Fährmann eine solche Höhle gezeigt, wo im vorigen Jahre eine »Schelle« ihre Jungen erbrütet hatte: ein Loch in einem wagrechten Ast einer uralten Föhre, gegen 3 m hoch über dem Wasser, der Eingang so eng, daß man nicht recht begreift, wie eine Ente sich hindurchzwängen kann. Hätte wohl sehen mögen, wie die kleinen Entchen aus der dunkeln Höhle mutig den Kopfsturz ins Wasser gewagt haben, ähnlich wie die Lummen von ihrer Helgoländer Felsklippe hinab in die bewegte See.
Die Schellenten hatten sich bei meinem Besuch noch[167] nicht in Pärchen aufgelöst, sondern hielten in größeren Trupps kameradschaftlich zusammen. Ein Vergnügen war's, ihnen zuzuschauen, wie sie unaufhörlich im Wasser verschwanden und dann leicht wie ein Kork wieder auftauchten; bald waren nur wenige, bald gar keine, bald war wieder die ganze Gesellschaft auf der Oberfläche zu sehen.
Von den Taucherarten beherbergt der Teich den großen Haubentaucher in mehreren Paaren, die kleineren Rothalstaucher und die noch viel kleineren Zwergtaucherchen, die in großer Anzahl ihre Künste zeigten, während ich Schwarzhalstaucher hier nicht bemerkte.
Die Haubentaucher, deren weiße Brust bei jeder Wendung des Vogels aufblitzt und wieder verschwindet, waren ziemlich mißtrauisch; sie versanken im Nu unter dem Wasser, wenn sich ihnen unser Boot näherte und tauchten erst in großer Entfernung wieder auf oder erreichten, unter dem Wasser schwimmend, die Nähe des Ufers, wo sie das Schilf unsern Blicken entzog.
Viel weniger Scheu zeigten die Rothalstaucher; ja ein Pärchen, das mit dem Nestbau eifrigst beschäftigt war, ließ mich bis auf wenige Meter herankommen. Wie schön sind doch auch diese Taucher! Rostrot der Hals, die Kehle und zwei Wangenflecken weiß; statt der eigentlichen Haube aber zwei schöne nach hinten gerichtete Federohren. Unermüdlich tauchten die Vögel nach allerlei Wasserpflanzen und legten diese Baustoffe auf die Schilfkaupe, die sie sich zur Niststelle erkoren hatten. Es war schon ein großer Klumpen, naß, schlammig und übelriechend, zusammengetragen; aber den beiden schien's immer noch nicht genug.
Der kleinste der Tauchersippe, der niedliche Zwergtaucher,[168] ließ oft seine trillernde Stimme hören, eine ganze Kette perlender, etwas absinkender Töne, die das Tierchen jedem verraten, der's nur einmal gehört hat. Aber dem Auge zeigte sich das Taucherchen immer nur auf kurze Sekunden; am Rande des Schilfwaldes trieb es das lustigste Versteckspiel oder tauchte unter, sobald es sich beobachtet sah.
Die Lachmöwen, die ihre braune Gesichtsmaske bereits aufgesetzt hatten, waren wohl nur zu Besuch gekommen. Ihr eleganter Flug belebte das Landschaftsbild reizvoll; einige ruhten auch auf der Wasserfläche aus, weißen Seerosen zu vergleichen, oder saßen eng aneinandergereiht auf einer Planke am Ufer. Ihre nächsten Brutplätze haben sie an manchem Teich der preußischen Lausitz.
Von Seeschwalben war natürlich noch keine Art zu erblicken; denn die Fluß- und Zwergseeschwalben kommen erst Anfang Mai. Dagegen zeigte sich in der Höhe ein Fischadler, weite Kreise über dem Gewässer ziehend und dann langsam in der Ferne verschwindend. In der sächsischen Lausitz brütet der edle Fischer nicht mehr; vielleicht daß die Lohsaer Forsten jenseits der preußischen Grenze seinen Horst noch beherbergen.
Aber einen andern Vogel, den wir auch heute noch mit Stolz als sächsischen Landsmann bezeichnen dürfen, konnte ich hier in Deutsch-Baselitz begrüßen, den weißen Storch. Es war mir eine große Freude, den Weitgereisten unmittelbar bei seiner Ankunft willkommen zu heißen.
Wir saßen gerade beim Mittagessen, als das jüngste blondhaarige Töchterchen unsers freundlichen Gastgebers[169] ins Zimmer stürzte: »Der Storch, der Storch ist da!« Alle sprangen auf und liefen nach der Rückseite des Hauses. Dort stand er auf seinem alten Horst im Wipfel einer schlank gewachsenen Linde und klapperte nach Herzenslust. So schmuck sah er aus; geradezu blendend das Weiß seines Gefieders und leuchtend das Korallenrot von Schnabel und Ständern. Herzerfreuend war es zu beobachten, wie sich auf der Dorfstraße alt und jung vor dem Storchennest einfand und strahlenden Auges zu dem »Glücksbringer« emporschaute. Besonders ein kleines flachsköpfiges Mädel von drei oder vier Jahren war voller Begeisterung, und altklug belehrte es mich, daß später der Klapperstorch kleine Kinder – ich verstand nicht, ob bringen oder haben würde. Auch noch andere Ortschaften der Lausitz beherbergen Störche; ich sah einen besetzten Horst beim Rittergut Kauppa in der Nähe von Commerau, einen andern in Wartha bei Königswartha, in Döbra, in Skaska, und überall waren die Störche, wie man mir sagte, am gleichen Tage, am 18. April, angekommen.
Nachmittags besichtigte ich die Einrichtungen der Fischzucht. Es handelt sich fast ausschließlich um Karpfen und Schleien; bei dem rationellen Betrieb sind die Erträgnisse außerordentlich gewachsen: viele hundert Zentner alljährlich. Aber es gibt Herrschaften in der Lausitz, die noch einmal so viel Fische züchten, ja das Rittergut Königswartha, zu dem allerdings 119 Teiche gehören – die meisten bereits im Preußischen gelegen – bringt unglaubliche Mengen dieser wohlschmeckenden Flossenträger auf den Markt; dennoch sei die Fischzucht, wie mir der dortige Fischmeister sagte, noch einer großen Steigerung fähig.
Darüber ließe sich viel Wissenswertes berichten; aber nicht den stummen Bewohnern des Wassers, sondern dem sangesfrohen und geschwätzigen Völkchen der Vögel galt mein Besuch. Während ich mich auf den Teichdämmen unter den duftigen Jungbirken erging und bei jedem Schritt ein halbes Dutzend Frösche, wiederholt auch sich sonnende Ringelnattern aufjagte, sang der Fitis unermüdlich aus jedem Gebüsch sein weiches Lied; die Singdrossel jubelt, der Zaunkönig schmettert, Blaumeischen zetert, der Weidenlaubsänger gibt sein einförmiges »Zilp-zalp« zum besten; aus dem Fichtenwald der häßliche Balzruf des Fasans, das Gurren des Ringeltaubers, das Trommeln des Buntspechts und Rotkehlchens sehnsuchtsvolle Strophe: überall selige Frühlingsstimmung.
Gegen Abend noch eine Fahrt auf dem Großteich. Das Kollern der Birkhähne, die auf einem freien, von Hochwald umsäumten Platz balzen, schallt weithin über die Wasserfläche. Behutsam nähern wir uns. Drei Hähne sind es, die mit ausgebreitetem »Spiel«, mit vorgestreckten Hälsen und hängenden Flügeln umherspringen. Wir sind so nahe, daß wir auch das Zischen der aufgeregten Tiere vernehmen und trotz der Dämmerung das leuchtende Weiß im Federkleid und die purpurne »Rose« über dem Auge ganz deutlich erkennen. Einige Hennen, klein und unscheinbar, sind in der Nähe; sie laufen, Nahrung suchend, umher, als kümmerten sie sich gar nicht um das unblutige Kampfspiel ihrer verliebten Ritter. Jetzt hat uns die Gesellschaft bemerkt; da flattern sie lautlos davon. Auch unser Nachen zieht leise auf seiner Bahn weiter. Aber es dauert nicht lange, da hören wir wieder das »Rodeln« oder »Kollern« der Hähne aus derselben Gegend. Das Birkwild ist nicht[171] eben scheu; es läßt sich nicht so leicht vergrämen wie der balzende Auerhahn.
Immer mehr senkt sich die Dämmerung über den See. Enten und Bläßhühner werden stiller, aber das Froschkonzert schallt lauter und lauter. Welch ohrenbetäubender Lärm wird aber in ein paar Wochen am Abend und die ganze Nacht hindurch bis zum goldnen Morgen hier herrschen, wenn die Teich- und Drosselrohrsänger zurückgekehrt sind und nun ihr vielstimmiges Konzert geben. Heute ist's ein anderer, wenig bekannter Nachtschwärmer, dessen weithin schallender und doch weicher Flötenton uns erfreut. Es ist der Triel, der die sandigen Felder der Lausitz, die lichten Kiefernwälder und Waldblößen bewohnt; auch in der sächsischen Flachlandschaft westlich der Elbe ist der scheue Dämmerungsvogel, der zu den Regenpfeifern gehört, nicht selten. Seine Rufe – meist zwei oder drei sich eng aneinanderschließende Flötentöne von überaus angenehmem Wohlklang – erhöhen den Reiz der lauwarmen Frühlingsnacht.
Von Eulen ließ sich in der Nähe des Dorfes nur das Steinkäuzchen hören. Erst rief ein Männchen ein paarmal sein pfeifendes »Guhk«, dann antwortete ihm ein zweites mit demselben Gruß, und bald lockte ein Weibchen mit hohem »Kuwiff, kuwiff«.
Am Morgen des nächsten Tages, den als erster Sänger Hausrotschwänzchen mit klirrender Strophe begrüßte, zeigte sich am Ufer des Großteichs in den hohen Eichen ein Wiedehopf. Ich vernahm seinen kuckucksähnlichen Ruf »upupupup« schon längst, ehe ich den hübschen Vogel mit dem aufrichtbaren, lockeren Federbusch und dem langen, dünnen Schnabel zu Gesicht bekam.[172] Der muntere Bursche war außerordentlich scheu; bis auf 50 Meter nur ließ er mich herankommen. Dann flog er immer ein Stückchen weiter auf eine andere Eiche, bis er schließlich in zuckendem, unregelmäßigem Flug über die breite Wasserfläche setzte.
Durch Wiesen und Felder führte mich der Weg weiter nach Milstrich. Die reizenden Flugspiele der Kiebitze, die mich so nah umflatterten, daß ich das seltsame »Wuchteln« ihrer Schwingen deutlich vernahm, belebten die freundliche Landschaft; auch ein paar Turmfalken zeigten ihre Künste. Im Dorf sah ich die ersten Schwälbchen, zwei oder drei Paar Rauchschwalben, auch eine einzelne Hausschwalbe; sie zwitscherten seelenvergnügt, froh, daß die schlimme Zeit nun vorüber und Wärme und Sonnenschein das kleine Volk der Insekten zu neuem Leben geweckt hatten.
Zu dem Milstricher Rittergut gehören gleichfalls viele, zum Teil recht ansehnliche Teiche. Sie sind von nur geringer Tiefe, vielleicht einen Meter im Mittel. Das ist ein Vorzug aller stehenden Gewässer der Lausitz; denn das Wasser erwärmt sich dadurch schnell bis auf den Grund, was der Fischzucht förderlich ist. Außer den schon genannten Enten, Tauchern, Wasserhühnern belebten auch kleine Moorenten die Teiche in der Nähe des Gutes. Ziemlich unscheinbar sehen diese Entchen aus. Selbst das »Prachtkleid« des Erpels verdient kaum solchen Namen; denn das dunkle Kastanienbraun des Kopfes und die Rostfarbe der Brust sind nur ein bescheidener Schmuck. Die Moorenten tauchen vorzüglich. Sobald ich mich nur ein wenig näherte, gleich waren sie unter dem Wasser, wenn sie nicht vorzogen, unter »grrr-grrr«-Rufen abzuziehen, stets paarweise, erst das Weibchen[173] und hinter ihm das etwas größere Männchen. Während des Schwimmens sehen die Moorenten sehr klein aus, weil sie den Hals einziehen und mit dem Rumpf tiefer ins Wasser eintauchen als andere Enten, so daß man geradezu überrascht ist, wenn das Entchen beim Auffliegen gewiß noch einmal so groß erscheint, als man erwartet hätte.
Recht häufig vernahm ich den angenehmen Trillerpfiff des kleinen Rotschenkels; er ist unser verbreitetster »Wasserläufer«, an den orangeroten Füßen und dem weißen Bürzel leicht zu erkennen. Die weithin hörbaren Lockrufe »tü, tütü, dili, dideli« und die schwirrenden Triller sind so charakteristisch, daß es jeder Vogelkenner sofort weiß, welcher Vogelkehle diese wohllautenden Töne entstammen. Besonders eifrig rufen die Rotschenkel gegen Abend; dann antworten ihnen die Zwergtaucher mit gleichfalls trillernder Strophe.
Weiße Bachstelzen und die noch zierlicheren Gebirgsbachstelzen sah ich sehr häufig; auch die reingelbe Wiesen- oder Schafstelze, die ungefähr drei Wochen später kommt als ihre Verwandten, war schon da und wippte graziös von einem Schilfinselchen zum andern. Auf den Feldern ließen sich gegen Abend die Rebhühner eifrig hören, und auch Heidelerchen sangen noch spät ihr zartes, aus einer Reihe von Pfeiflauten bestehendes Lied aus luftiger Höhe herab.
Der folgende Tag galt dem Besuch des Königswarthaer Teichgebiets im Norden der Ortschaft. Teich an Teich in unübersehbarer Folge, und fast auf jedem eine stattliche Zahl von Wassergeflügel, daß dem Naturfreund das Herz lacht. Zehntausend Morgen an Wasserfläche[174] gehören zum Rittergut, der kleinere Teil davon im Königswarthaer Flurgebiet, der größere schon auf preußischem Boden. Einige von ihnen sind 50 bis 72 Hektar groß. Hier fielen mir besonders die zahlreichen Löffelenten auf. Möglich, daß ich diese schöne Ente auf den früher besuchten Teichen übersehen oder vielleicht aus der Entfernung mit der Stockente verwechselt hatte: jedenfalls gehört sie in dem Königswarthaer Teichgebiet zu den ganz allgemein verbreiteten Arten. Eigentümlich ist für sie der große, am Grunde schmale, vorn aber stark verbreiterte, gewölbte Schnabel, dessen Form der Ente den Namen gegeben hat. In seinem Prachtkleid führt das Männchen viel Weiß, das weithin leuchtet, besonders am Kropf, Hals und Oberflügel. Der Kopf erglänzt schwarzgrün wie beim Stockerpel. Unterbrust und Bauch zeigen ein schönes Kastanienbraun. Vor dem goldgrünen, weiß eingefaßten Spiegel liegt über der Schulter ein himmelblaues Feld, eine Farbe von eignem Reiz; sie ist in unsrer deutschen Vogelwelt außerordentlich selten. Öfters sah ich Löffelenten ganz in der Nähe, immer paarweise; sie sind so wenig scheu, daß sie auch dann noch unbesorgt umherschwimmen oder gründelnd sich auf den Kopf stellen, wenn Bläßhühner, Stockenten, selbst die zutraulichen Tafelenten unter Geschrei geflohen sind. Fliegen auch sie endlich ab, so geschieht es ohne jeden Laut; ohne Plätschern erheben sie sich aus dem Wasser, und ohne jedes Geräusch fallen sie wieder ein.
Im Parke hinter dem Herrenhause fand ich all die Vögel, die ich hier erwarten konnte. Von den noch nicht erwähnten nenne ich nur Wendehals, Gartenrotschwanz, Sumpfmeise, Kleiber, Baumläufer, denen die höhlenreichen[175] Bäume willkommene Wohnung gewähren, dazu Freibrüter wie Hänfling und Girlitz. Auch ein paar Eichelhäher kreischten in den Baumkronen.
Den folgenden Tag fuhr ich nach Neschwitz, von wo aus ich die nahen Holschaer und Quooser Teiche, den schön gelegenen Mädelteich, den Litschen- und Neuteich, die Mauerlöcher, ferner die Radiborer Teiche an der Luppaer Grenze, die Luttowitzer Teiche, den Bockauer Großteich, und endlich die schönsten von allen, die Milkener Teiche besuchte. Die ganze Gegend mit dem reichen Wechsel von Wasser, Wald, Wiese und Feld, mit den freundlichen, zumeist wendischen Ortschaften ist von hohem landschaftlichen Reiz, und ich freue mich, daß man all diese liebliche Schönheit hier ungestört genießen kann. Die Gegend ist eben noch nicht »entdeckt«, und so verliert sich wohl nur selten mal ein Tourist in diesen Winkel der »wendischen Türkei«. Es ist nicht möglich, alle Beobachtungen aufzuzählen, die Auge und Ohr eines aufmerksamen Wanderers jede Minute beschäftigen: die anheimelnde Bauart der ländlichen Höfe, die sich um den unkenreichen Dorfteich gruppieren, die blühenden Obstbäume, die Rehe am Waldessaum, der kreisende Mäusebussard, die Karnickel vor ihrem Bau, der wohlklingende Ruf des Schwarzspechts, das Rucksen der Hohltaube, hier Reinekes Spur, der seine Besuchskarte abgegeben hat, dort Gewölle vom Waldkauz, hier die Fegstelle eines Rehbocks an zwei jungen Erlenstämmchen, ein Igel im Gestrüpp, die Fährte des Iltis, oder manche interessante Pflanze: im schattigen Wald die Einbeere, Knabenkraut auf der feuchten Wiese, Sumpfveilchen auf moorigem Boden, Pestilenzwurz, Leberblümchen u. a. Ein Eisvogel flog wie ein glühender Juwel vorüber und weckte[176] die Erinnerung an jenen gleichfalls farbenprächtigen Vogel, die Mandelkrähe oder Blaurake, die leider in Deutschland immer seltener wird, aber im östlichen Sachsen, so bei Königswartha und in den hohen Eichen an den Quooser Teichen noch regelmäßig als Brutvogel vorkommt. Diesmal freilich konnte ich den wunderbar gefärbten Vogel noch nicht begrüßen, da er erst recht spät aus seiner Winterherberge zurückkehrt.
Nach Fischreihern habe ich scharf Ausschau gehalten; aber erst am vierten Morgen glückte es mir, einem dieser schönen Vögel zu begegnen. Ich hatte in Commerau übernachtet und saß auf dem Damm eines der vielen Teiche in der dortigen Heide beim Frühstück. Auf einmal hinter meinem Rücken ein aufgeregtes Kreischen der Lachmöwen. Ich wende den Kopf – kaum zwanzig Schritt von mir ein Reiher, der von den Möwen bis unter die Bäume am Damm verfolgt ward, wo sie ihn nun in die Enge treiben. Er wird mich gewahr, schlägt heftig mit den dunkeln Fittichen, wendet und bahnt sich den Weg mitten durch die ihn umschreiende Schar.
Fischreiher horsten nicht mehr in der sächsischen Lausitz; aber im nahen Lohsa-Weißcollmer Revier findet sich auf hohen Kiefern wohl auch heute noch der Rest einer uralten Kolonie. Im Juli und August, wenn die Jungen ausgeflogen sind, erscheinen dann mit ziemlicher Regelmäßigkeit die schönen Fischer auch im sächsischen Teichgebiet, nicht selten mehr als ein Dutzend auf einmal, zum Ärger der Teichbesitzer, die über die preußischen Fischdiebe schimpfen und manchem das Lebenslicht ausblasen.
Der merkwürdigste Vogel jener Gegend ist aber die[177] große Rohrdommel. Ihretwegen war ich nach Commerau gewandert, und ich hatte das Glück, die ganze Nacht ihrem Liebeslied von meinem Bett aus zu lauschen. Obgleich der Standort des Vogels mindestens eine halbe Stunde von dem Gasthaus entfernt war, hörte ich das tiefe »Prumb« doch ganz deutlich. Es klingt ähnlich wie das Brüllen eines Rindes, weshalb der Vogel beim Volk »Moorochse« genannt wird. Meist hörte ich, selbst bei dieser Entfernung, auch den viel leiseren Vorschlag. Die Silben »ü-prumb« geben den Ruf ziemlich gut wieder. Auch am hellen Morgen, den ganzen Vormittag, selbst in den Mittagsstunden schwieg die Rohrdommel nicht, nur daß sie jetzt ihren Ruf statt fünf- oder sechsmal, nur etwa dreimal hintereinander wiederholte und dann eine Pause von ein paar Minuten eintreten ließ. Wie man bei der Birkhahnbalz aus dem Kollern allein, das dem sog. Schleifen vorangeht, den Standort des Hahns nur schwer bestimmen kann, so verhält sich's auch mit dem tiefen »Prumb«-Laut des reiherartigen Vogels; es dauerte ziemlich lange, ehe ich feststellen konnte, daß auf einer Insel in einem Teich ganz nahe dem Rittergut Kauppa die Rohrdommel ihren Standplatz bezogen hatte. Die Leute sagten, seit zwei bis drei Wochen ließen sich diese unheimlichen Laute hören; daß sie von einem Vogel herrühren, wollte mir niemand glauben. In der Nähe klingt das »Prumb« – wohl der tiefste Ton, den irgendein Vogel unsrer Heimat erzeugt, denn er erreicht das F der großen Oktave – etwa so wie der Laut, den man mittels einer recht großen Gießkanne erzeugen kann, wenn man mit voller Kraft Luft zur Ausflußröhre hineinbläst. Ein Explosionslaut ist es, der nicht mit dem Kehlkopf, sondern[178] mit der Speiseröhre erzeugt wird, aus der die hinuntergeschluckte und zusammengepreßte Luft mit großer Gewalt herausgestoßen wird, eine Art Dudelsack, auf dem der scheue Vogel sein unheimliches Liebeslied spielt.
Auch im Neschwitzer Teichgebiet ließ sich die große Rohrdommel unermüdlich hören. Leider bekam ich sie aber weder hier noch dort zu Gesicht. Der Schilfwald hält sie versteckt, und wenn man sich ihrem Standort nähert, so flüchtet sie geduckt durch das Röhricht, wie der kleine Wachtelkönig durch das hohe Gras der Wiese. Aufzufliegen entschließt sich der Vogel nur schwer; er weiß, wo er Schutz findet.
Vielleicht gelingt es mir später, den nächtlichen Musikanten von Angesicht zu Angesicht zu sehen, vorausgesetzt, daß er unsrer Heimat erhalten bleibt. Ich habe sehr darum gebeten, ihn bei den Entenjagden als interessantes Naturdenkmal zu schonen und ich wiederhole auch hier meine Bitte.
Jahrhundertelang fließt der Fluß in dem errungenen Bett. Wann sprang sein Quell zum erstenmal aus dem Felsen hervor? Wird einst das Wasser verrinnen, wird die Spur verwehen, die es in das Antlitz der Erde gegraben hat? Beharrungsstreben in der Natur trotz allen Wechsels – wie viele selbst der kleinsten Bächlein mögen heute noch genau so fließen, wie weiland vor tausend Jahren!
Mit der Kultur des Menschengeschlechts ist's, ebenso. Unerforschlich ihr Ursprung, unbekannt Ziel und Ende, und bei allen Wechselfällen, bei allen Umwälzungen des Lebens das Gesetz der Beharrung. Greife heraus, was du willst, Gebräuche und Sitten, Anschauungen, Sagen und Märchen, Sprache, Werkzeug und Kunst – uralter Besitz ist's, vererbt von Geschlecht zu Geschlecht. Manches wohl tot – nur die Erinnerung, daß es einst war, ist noch geblieben – vieles nur scheintot – zu neuem Leben kann es erwachen – das meiste aber noch frisch und in Urkraft, wie in den Tagen der Väter.
Unter diesem Gesichtspunkte betrachtet der denkende Mensch auch den Aberglauben oder sagen wir lieber – denn gemütvoller klingt es – den Volksglauben, den er noch heute im aufgeklärten zwanzigsten Jahrhundert[180] bei seinen Zeitgenossen antrifft. Ihn bis in die nebelgraue Vergangenheit zurückzuverfolgen, seine verborgenen Quellen und die vielen Bächlein aufzusuchen, die ihn immer von neuem gespeist haben, das ist der Reiz, den solches Studium gewährt. Der andere aber mag nichts davon wissen; er sagt: »Die Dummen werden nicht alle!« Kennt er sich selbst so genau? Ist er wirklich ganz frei, ganz unbefangen, oder schlummert nicht vielleicht doch irgendein kleines Überbleibsel, ein winziger Rest dieser oder jener uralten abergläubischen Vorstellung, ihm selbst nicht bewußt, in seiner so aufgeklärten Seele?
Wir wählen ein eng umgrenztes Gebiet, den Volksglauben, der sich auf die gefiederte Welt unsrer Heimat bezieht, und zwar nur so weit, als er noch heute bei unsern Volksgenossen lebendig ist.
Da gibt es zuerst naturwissenschaftliche Irrtümer, die nur insofern die Bezeichnung Volks- oder Aberglauben verdienen, als sie so seltsam sind, jeder Erfahrung so völlig widersprechen, daß eine starke Gabe von Leichtgläubigkeit und kindlicher Einfalt dazu gehört, wenn jemand noch immer an solchen Widersinnigkeiten festhält.
Ob man mir's glaubt? Das Märlein vom Kuckuck, unserm lieben Frühlingsboten, der sich alljährlich im Herbst in einen raubgierigen Sperber verwandeln soll, ist auch heute bei unserm Volk noch nicht völlig verklungen. Zehn Jahre sind's her, da saß ich mit zwei Landwirten am Biertisch im Kretscham eines Lausitzer Dorfs. Beide waren Jäger; so kam die Unterhaltung bald in Fluß, und wir erörterten schließlich jene seltsame[181] Verwandlungsgeschichte. Es waren die vernünftigsten Menschen der Welt; aber sie ließen sich doch nur halb überzeugen. Zwar an die Verwandlung glaubten sie nicht; aber daß der Kuckuck auch im Winter unsrer Heimat treu bleibe und daß er, sobald die Raupennahrung spärlicher werde, der Kleinvogelwelt nachstelle, daß er dann ein schlimmer Räuber sei, das ließen sich beide nicht ausreden. Der eine der Streithähne wollte einmal mitten im Winter einen Kuckuck geschossen haben, als dieser gerade einen Finken würgte; der andere aber hatte an einem sonnigen Maimorgen beobachtet, wie sich der Kuckuck-Sperber oder der Sperber-Kuckuck, der eben noch seinen prophetischen Ruf zum besten gegeben hatte, auf ein singendes Rotkehlchen stürzte.
Schon zu des seligen Äsops Zeiten meinte man, aus dem Kuckuck werde im Herbst ein Sperber oder ein Habicht, und dieser verwandle sich im Frühjahr wieder in den Lenzesboten. Auch Aristoteles erwähnt den gleichen Aberglauben, dem er jedoch mit aller Entschiedenheit entgegentritt. Plinius aber muß den großen Gelehrten mißverstanden haben, wenigstens berichtet er wieder: »Der Kuckuck entsteht aus einem Raubvogel.« Damit war diese Transmutationslehre für viele Jahrhunderte gesichert; bei den »Naturkündigern und Philosophi« erhielt sie sich das ganze Mittelalter hindurch, und ein oder der andere Mann aus dem Volk glaubt heute noch an das einfältige Märchen.
Wer Kuckuck und Sperber kennt, wird über die Entstehung des sonderbaren Aberglaubens nicht im Zweifel sein. Der unschuldige Kuckuck ahmt den gefürchteten Sperber so vollkommen nach in Gestalt, Größe und Farbe, ja sogar in der Art seines Fluges, daß der Beobachter[182] leicht getäuscht wird. Die Unterseite weißlich mit dunklen Querwellen, der Fächer des Schwanzes lang und breit, das hochgelbe Auge, die gelbliche Wurzel des Oberschnabels, der blaßgelbe Fuß, dazu der Flug, leicht, elegant und reißend schnell wie der unsrer kleinen Raubvögel: dies, alles sind Merkmale, die Freund Kuckuck mit dem verhaßten Sperber teilt. Ich zweifle keinen Augenblick, daß es beim Flug über freies Feld dem harmlosen Lenzesboten bisweilen gelingen wird, durch diese Maske seine Feinde, die gefiederten Räuber, zu täuschen.
Denselben Eindruck, daß der Kuckuck ein Raubvogel sei, haben offenbar auch die Kleinvögel, wie Grasmücken, Laubvögelchen, Würger, Bachstelzen u. a.; ihnen allen ist der Kuckuck ein gar unheimlicher Geselle. Zeigt sich einer in ihrem Gebiet, so flattern sie erschreckt von Ast zu Ast, ängstlich rufend, oder sie versuchen es, den vermeintlichen Angriff gemeinsam zurückzuschlagen, indem sie den Ruhestörer mit lautem Geschrei verfolgen. Oder sollten sie es wissen, daß ihnen das Kuckucksweibchen sein Ei ins Nest legt, und sollten sie es nun mit allen Mitteln versuchen, das Danaergeschenk zurückzuweisen? Ich glaube es kaum. Durch solche Zeichen von Furcht und Aufregung unter den Kleinvögeln wird natürlich auch der menschliche Beobachter leicht irregeführt.
Andere berichten, der Kuckuck verkrieche sich im Herbst in hohle Bäume, besonders gern in Weidenstämme, auch unter Steine und in die Erde. Hier liege er wie tot, und zwar nackend, auf seinen Federn, gleichsam in einem warmen Bett, »faulen vnd vngefäder«, wie es beim alten Geßner heißt, dem Plinius am Ausgange des Mittelalters.
Es ist überhaupt merkwürdig, daß man sehr vielen Vögeln, von denen wir heute wissen, daß sie Zugvögel sind, einen Winterschlaf hier in ihrer Heimat andichtete. Die Erscheinungen in der Welt der Säugetiere, Reptilien und Amphibien mögen einen solchen Ähnlichkeitsschluß nahegelegt und manche Einzelbeobachtungen diese irrige Annahme bestärkt haben. Rotschwänzchen, Turteltaube, Amsel, Nachtigall, Wachtel u. a. verkriechen sich, so meinte man, in Baumhöhlen, Felsenritzen, unter Baumwurzeln, in die unterwaschenen Flußufer und verbringen hier die rauhe Jahreszeit im Halbschlaf oder in festem Winterschlaf, wobei sie – namentlich die Wachteln – von ihrem Fett zehren, wie Dachs oder Bär.
Am merkwürdigsten aber waren die fabelhaften Erzählungen über das Winterquartier von Schwalbe und Storch. Diese Vögel sollten auf dem Grund von Teichen, Seen und Sümpfen, ja selbst im Meer überwintern. Hier, vom Schilfe verdeckt, ruhen die müden Geschöpfe und erquicken im Schlaf, der dem Tode gleicht, die ermatteten Glieder. Noch vor wenig mehr als anderthalb hundert Jahren wird diese sonderbare Ansicht in Kleins »Historie der Vögel«, Danzig 1760, auf das bestimmteste gegen alle Einwände verteidigt, so daß man sich nicht wundern darf, wenn weit über zweihundert Jahre früher Luther in seiner Erklärung zum 1. Buch Mose sagt: »Das Wunderwerk von den Schwalben ist aus der Erfahrung bekannt, daß sie nämlich den Winter hindurch in dem Wasser für tot liegen und im Sommer wieder aufleben, welches gewiß ein großer Beweis unsrer Auferstehung ist.« Auch Luthers Zeitgenosse, der alte Geßner, führt in seinem »Vogelbuch«[184] diesen Gedanken aus; er sagt … »welches ich für ein wunderbar werck halt vnd für ein anbildung der auferstentnuß vnserer cörpeln.«
An diesem Wunderglauben hält heute wohl niemand mehr fest; aber daß unsre Schwalben, wenigstens ein großer Teil von ihnen, in hohlen Bäumen, unter dürrem Laub und zwischen Grasbüscheln oder auch in ihren eigenen Nestern einen regelrechten Winterschlaf halten, dieses Märlein spukt noch immer in unserm Volke und in den Zeitungen fort und ist trotz aller Aufklärung seitens der Wissenschaft, wie es scheint, nicht aus der Welt zu schaffen. Es werden selten ein paar Jahre vergehen, wo dieser Irrtum und Aberglaube nicht immer wieder durch einzelne »einwandfreie« Beobachtungen neue Nahrung erhielte. Und das erklärt sich so: Vor dem Abzuge suchen die Schwalben gern gemeinsame Schlafplätze auf, wie das Schilf an Teichen, das Fachwerk der Häuser, auch einmal eine weite Baumhöhle. Sind die Tierchen, die vielleicht wegen verspäteter Brut den Anschluß an die große Masse der Wanderer versäumt haben, infolge Nahrungsmangels halb verhungert, so kann es geschehen, daß sie in kalter Herbstnacht dutzendweise dahinsterben, und wer sie findet, meint dann, die Schwalben hätten sich hier zum Winterschlaf niedergelassen. Auch Lenz ist überzeugt, daß diese Vögel in Europa, wenn auch nur ausnahmsweise, einen Winterschlaf halten.
Solche Fälle stehen durchaus nicht so vereinzelt da, wie wohl mancher denken mag. In den letzten Jahrzehnten haben wir es mehrmals erlebt, daß Schwalben in den naßkalten Herbsttagen – sehr verhängnisvoll waren für sie z. B. die ersten Oktobertage 1905 – nicht[185] nur einzeln, sondern in ganzen Scharen zugrunde gingen. Selbst unter dürres Laub, unter Grasbüschel und dergleichen hatten sich ermattete Rauchschwalben versteckt, gemeinsam die Todesstunde erwartend. Daß man auch zwischen dem Schilf »ganz aneinanderhangende Bündel« von Schwalben aus dem Wasser gezogen haben will, erscheint unter solchen Umständen durchaus nicht so unmöglich, sondern ist leicht zu erklären. Wenn aber jeder Vogel, den einmal ein Fischer aus dem schilfigen Teich oder See herauszieht, nun sofort als Winterschläfer ausposaunt wird, wie es ehemals oft geschehen ist, so gibt es für solche Leichtgläubigkeit und Urteilslosigkeit keine Entschuldigung; denn das weiß jedes Kind, daß im Sommer und Herbst mancher Vogel den Hunden des Schützen, der auf Enten oder andere Wasservögel jagt, nur zu leicht dadurch entgeht, daß er zwischen das Schilf flattert und dort ins Wasser fällt. Auch der beste Hund findet nicht jede einzelne Beute.
Noch ein Schwalbenmärchen, das freilich mit Aberglauben gar nichts zu tun hat – nur das ewige Leben teilt es mit ihm – sei hier erwähnt. Dem Sperling, der sich in ein Schwalbennest einquartiert hat, so heißt es ganz allgemein, gehe es schlecht. Die erzürnten Schwälbchen kümmerten sich nicht um das »Besetzt, besetzt!« das ihnen der Eindringling zuruft, und mauerten den Spatz aus Rache einfach ein, daß er elend umkommen müsse.
Ein Märchen ist es. Wohl flattern und schreien die rechtmäßigen Besitzer, wohl schnappen sie im Fluge nach dem frechen Sperling; doch der weicht nicht von der Stelle. Nach ein oder zwei Tagen geben dann die Schwalben in der Regel ihre Angriffe auf, und der[186] Spatz hat nun Ruhe. »Gesiegt, gesiegt!« so höhnt er, sobald noch ein Vogel vorüberfliegt. Wie sollten sich die ängstlich umherflatternden Schwalben auch soviel Ruhe und Überlegung bewahren, daß sie unmittelbar vor dem Kopf ihres zeternden Feindes die Öffnung des Nestes zumauerten, und – nun kommt die Hauptsache – so dumm ist unser Spatz, »der Allerweltsvogel, der pfiffige Gassenjunge, der Lausbub«, wahrhaftig nicht, daß er sich solch Einmauern bei lebendigem Leibe gutmütigst sollte gefallen lassen. Er hat auch einen Schnabel und weiß sich zu wehren.
Recht sonderbar ist der auch heute noch beim gemeinen Mann verbreitete Glaube, das Nest des grünen Erlenzeisigs, der so gern als Stubenvogel gehalten wird, sei unsichtbar. Ja man wollte mich sogar einmal Lügen strafen, als ich behauptete, den Zeisig beim Füttern seiner Nestjungen beobachtet zu haben, und das von mir vorgezeigte Nest, das mir einst ein Junge vom Baume herabgeholt hatte, wurde für ein solches vom Stieglitz oder vom Hänfling erklärt.
Es ist gar keine Frage, das Nest vom Zeisig gehört zu den Vogelnestern, die recht schwer aufzufinden sind. Meist steht es hoch oben in den Fichten oder Tannen, von Nadelzweigen und Flechten so gut verdeckt, daß es von unten und von den Seiten her in der Regel nicht gesehen werden kann, und wenn man in diesem Sinne von einer »Unsichtbarkeit« des Zeisignestes sprechen will, laß ich's wohl gelten. Selbst wer den Baum erklettert, findet es oftmals nicht, so genau er sich auch die Stelle, wo er die Vögel bauen oder mit Futter herzufliegen sah, gemerkt hat. Dazu steht das Nest meist auf dem schwanken[187] Ende eines Astes, daß es höchstens von einem waghalsigen Jungen erreicht werden kann.
Ich habe auch einmal sagen hören, falls der Zeisig überhaupt brüte und sich nicht etwa auf eine »unnatürliche Art« fortpflanze, so müsse das während des Winters, wo die Vögel umherstreichen, in einer fremden Gegend geschehen; bei uns zulande wenigstens habe noch kein Mensch ein einwandfreies Zeisignest gefunden. Nun, ich kann nur feststellen, daß in den Nadelwäldern unsrer Mittelgebirge, wie im Thüringer Wald und im Harz, alljährlich genug Zeisige ihr Fortpflanzungsgeschäft im Frühjahr ganz ebenso betreiben, wie andere Finkenvögel auch. Und wenn man weiter fabelt, das Nest enthalte einen Stein, der ihm jene Unsichtbarkeit erst verleihe, und nur auf einer Wasserfläche spiegele es sich ab, so daß man dort wohl sein Bild, nie aber das wirkliche Nest sehen könne, so trägt solch Gerede auch nicht dazu bei, die Sache glaubwürdiger zu machen.
Besonders sind es unsre Hausfreunde, wie Storch, Schwalbe, Rotschwänzchen, um die man einen ganzen Kranz abergläubischer Vorstellungen gewunden hat. Zwar an den Storch als Kinderbringer, den »Adebar«, der die Mutter ins Bein beißt, daß sie das Bett hüten muß, glauben heutzutage selbst die kleinen sechsjährigen Mädel nicht mehr recht und die Buben gleich gar nicht; aber daß Störche auf dem Haus eine nahe Hochzeit oder Kindersegen bedeuten, daran hält man in unsrer Lausitz, wo es zum Glück noch immer ein paar besetzte Horste gibt, ebenso fest, wie in andern Gauen des niederdeutschen Flachlandes, die sich zahlreicherer Störche erfreuen. Soviel Junge im Nest, soviel Kinder sollen auch die Neuvermählten bekommen –[188] natürlich nacheinander, im Laufe der Jahre; denn in Adebars Kinderstube werden gewöhnlich vier, bisweilen auch fünf Stück zur Welt gebracht.
Ebenso allgemein ist der Glaube, daß ein auf dem Hause brütendes Storchenpaar jede Feuersgefahr abwende; namentlich wird der Blitzschlag ein solches Gehöft nie einäschern. Ich kenne einen Fall in der Lausitz, wo eine Feuersbrunst tatsächlich vor einem durch Störche gefeiten Gute halt machte. Dadurch wird natürlich der Glaube, daß das Feuer dem Vogel und seinem Horst nichts antun könne, zur Gewißheit; noch die Urenkel werden davon erzählen, während die Fälle, wo sich der Schutz nicht bewährte, recht bald der Vergessenheit angehören. Ich werde der letzte sein, der es versucht, dem Lausitzer Bauer seinen Glauben auszureden; denn der liebe Mitbewohner des Hauses erscheint ihm ja wegen des Feuerschutzes, den er dem Hofe gewährt, nur um so wertvoller.
Fast ein heiliges Tier ist unser Hausstorch wie bei den Ägyptern der Ibis oder in Indien der Geier. Wehe wer einen Storch tötet oder ihm ein Junges raubt – Krankheit und Armut werden des Mörders Los. Ja, der Glaube an die Unverletzlichkeit und Heiligkeit des gefiederten Hausfreundes ist unserm Volke so in Fleisch und Blut übergegangen, daß selbst Forstbeamte – es sei ihnen zur Ehre angerechnet – davon abstehen, einen Storch zu schießen, auch wenn sie davon überzeugt sind, daß in ihrem Revier der langbeinige Vogel manchen Schaden anrichtet, indem er in den Feldern weidwerkt und neben Mäusen auch 'mal einen Junghasen erwischt oder ein bodenständiges Nest ausnimmt. Aber der Jagdberechtigte weiß auch, daß er gut[189] daran tut, ein Auge zuzudrücken. Die ganze Gemeinde würde mit Recht empört sein, wenn es hieße, der Storch, ihr Gemeindestorch, sei dem Schrot des Jägers zum Opfer gefallen. Ich kenne einen solchen Fall aus unserer Heimat; doch steht er zum Glück vereinzelt da.
Wie der Storch, so sind es unsre beiden Schwalbenarten, die Rauch- und die Mehlschwalbe, die nicht nur in unsrer Heimat, sondern in ganz Deutschland und weit über die deutschen Grenzen hinaus als günstige Vorzeichen gelten. Fliegen die Schwalben über einem Hause häufig hin und her, auch wenn sie dort nicht ihre Nester gebaut haben, so wird ein Mädchen in diesem Hause bald Braut. Glück und Segen winkt dem kommenden Ehestand, wenn das erste, was die Brautleute beim Austritt aus der Kirche erblicken, ein zwitscherndes Schwalbenpärchen ist. Vom Himmel gesandt sind diese Vögel; »Himmelsvögelchen« nennt sie der Volksmund.
Wie dürfte jemand solch liebem Tierchen ein Leid zufügen! Wer ein Schwalbennest zerstört, sagt der Volksmund, zerstört sein eignes Glück, und gar eine Schwalbe zu töten ist eine schwere Sünde, die gen Himmel schreit; der Frevler wird furchtbar bestraft mit Krankheit oder mit schnellem Tod. Dieser fromme Aberglaube ist bei unsern Landleuten auch heute noch so lebendig, daß sie die Belästigung seitens der Schwalben durch Schmutz und Kot gern mit in Kauf nehmen. Selbst an heiliger Stätte duldet man die Vögel und läßt sie ruhig ihre Nester bauen; für jeden Kirchgänger ist's ja doch nur ein fröhlicher, trauter, anheimelnder Anblick, wenn die heiligen Vögel durch das Heiligtum des Herrn über der Gemeinde hin und her fliegen und[190] ihre zwitschernden Jungen ätzen. Auch der Araber sagt: »Die Schwalbe preist Gott und beschmutzt die Moscheen.«
Der Aberglaube ist der wirksamste Geleits- und Schutzbrief für unsre Schwalben, mehr wert als jedes Gesetz. Und wer für seine Person auch nicht solchem Aberglauben zustimmt, den Anschauungen seiner Väter und Urväter gegenüber sollte er doch so viel Ehrfurcht haben, daß er sie als heilige Überlieferung aus längst vergangenen Tagen beachtet und sie weiter an seine Kinder und Enkel vermittelt. Auch von andern Tieren läßt sich eine ganze Reihe anführen, der Storch, der Marienkäfer, die Kreuzspinne u. a., für die alle der Aberglaube gewissermaßen die Krippe ist, die sie nährt, und der Schutzwall, der sie und ihr Haus sichert. Der Aberglaube hat eben auch seine guten Seiten.
Schwalben erfreuen sich auch als Wettervögel eines besonderen Rufes. Wenn sie am Morgen hoch in den Lüften segeln, so sagt man allgemein, wird der Tag schön, und sollten schon Gewitterwolken den Himmel bedecken, das Unwetter zieht seitwärts. Wenn die Schwalben aber unruhig unmittelbar über dem Boden oder an den Hauswänden dicht vorüberflattern, so bedeutet dies Regen »nach aller Vernünftigen Urteil«. Daß sich trotzdem einzelne der wetterkundigen Hausgenossen bisweilen verrechnen können, ersieht man aus dem bekannten Sprichwort: »Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.«
In der Volksmeteorologie spielen gerade die Vögel eine hervorragende Rolle; sie werden sehr häufig befragt. Für Schwankungen im Feuchtigkeitsgehalt, im Druck der Atmosphäre, sowie für Änderungen der Luftelektrizität haben sie, die leichtbeschwingten Bewohner[191] des Luftmeers, gewiß eine viel feinere Empfindung als wir Menschen. Wer aber die Meinung vertritt, daß man aus dem Verhalten gewisser Vögel die Witterung auf Wochen oder Monate vorausbestimmen könne, daß die Vögel ein »Vorgefühl« für künftige Witterungsverhältnisse besäßen, noch ehe irgendwelche Veränderungen in der Atmosphäre eingetreten seien, der stellt Behauptungen auf, die jeder Begründung entbehren und die – wenigstens teilweise – mit unter den Begriff des Aberglaubens gehören.
Hätten die Zugvögel ein sicheres Vorgefühl für die kommende Witterung, so würde es ihnen nicht einfallen, so oft in ihr Unglück zu fliegen, wie Stare, Lerchen und Schwalben, die häufig unter einem strengen Nachwinter leiden müssen, und wenn sie den regenreichen Sommer geahnt hätten, so würden manche Schafstelzen, Goldammern, Wachtelkönige u. a. ihre Nester doch ein Stückchen mehr vom Wasser abgerückt haben, um der Hochflut nicht zum Opfer zu fallen. Wetterregeln, aus Beobachtungen an unserer Vogelwelt abgeleitet, gibt es unzählige. Bestätigen sie sich, so spricht man davon; treffen sie nicht zu, so vergißt man's. Wie beim Lotteriespiel ist's: der eine Gewinn läßt die Unmasse der Nieten verschmerzen; sie sind bald aus dem Gedächtnis verschwunden.
Nur einige solcher Regeln will ich anführen. Der Landbewohner schwört auf sie auch heute noch im Zeitalter des Barometers und der Wetterwarten mit ihren täglichen Prognosen. Er will weiter in die Zukunft blicken als nur 24 oder 36 Stunden.
Klappert der Storch fleißig im März, so gibt es einen schönen Frühling und einen warmen Sommer.[192] Wenn die Stare zeitig im April brüten, so ist ein »Wonnemond« zu erwarten, der diesen Namen auch wirklich verdient. So lange die Lerche vor Lichtmessen (2. Februar) singt, so lange schweigt sie, des Nachwinters wegen, nach Lichtmessen still. Auf tiefen Schnee mag man sich vorbereiten, sobald die Saatgänse ziehen oder Bergfinken und andere Wintergäste einfallen. Spätbrütende Rebhühner prophezeien einen späten Winter.
Aus dem Ruf mancher Vögel schließt der Bauer auf Regen. Wenn die Elster viel gackert, der Pirol unausgesetzt flötet, der Wiedehopf so eigentümlich klagt, der Wendehals schreit und der Regenpfeifer seine Stimme hören läßt, dann soll man eilen, das ausgebreitete Heu zusammenzuraffen, denn der Regen ist im Anzuge. Andere wieder halten den schmucken Buchfink für den besten Wetterpropheten; wenn er seinen bekannten schrillen »Rulschton« hören läßt: »jörk, jörk«, dann dauert's nicht mehr lange, und es regnet in Strömen. »Gut-Wetter-Bot« ist dagegen die Bachstelze, das »Ackermännchen«, wenn es dem Bauer hinter dem Pfluge folgt, und die Lerche, wenn sie sich fröhlich trillernd in die Lüfte erhebt, nicht aber zwischen den Ackerfurchen sitzend eintönig ruft.
Der Hahn auf dem Hof ist schon seit alters ein guter Wetterprophet. Wenn er in den Nachtstunden kräht oder sonst auch nur heftig mit den Flügeln schlägt, so kommt Regen und Sturm; kräht er aber am Morgen anhaltend, so folgt ein schöner Tag. Das wußte schon Älian, und noch heute heißt's bei unsern Bauern genau so. Aber gleich den wissenschaftlichen Meteorologen ist auch[193] der Hahn nicht gegen jeden Irrtum gefeit, und so hat man, damit er trotzdem in allen Fällen recht behalte, den schönen Reim ersonnen:
Sobald es zu regnen beginnt, soll man auch die Hühner beobachten. Treten sie sogleich unter Dach oder suchen sie den Stall auf, so wird der Regen bald vorübergehen; laufen sie aber anfangs nur unschlüssig hin und her und lassen sie sich endlich durch die Nässe kaum noch stören, so hält der Regen wenigstens einen vollen Tag an. Auch wenn sich Hühner und Tauben im Sande baden, bedeutet es Niederschläge.
Man könnte ein ganzes Buch füllen, soviele Wetterregeln leitet der Bewohner des Landes aus dem Verhalten der Tiere, ganz besonders aus dem der Vögel ab. Der Ackersmann, der Schäfer, die Bäuerin, die daheim das Regiment führt, der Jäger, der Fischer, der Gärtner, der Waldarbeiter, der Seemann, kurz jeder, dessen Arbeit und Erwerb von der Witterung unmittelbar abhängig ist, hat seine Erfahrungen gesammelt. Außer den bereits genannten Vögeln wären noch Kranich und Fischreiher, der große Brachvogel – er wird geradezu »Gewittervogel« genannt – Misteldrossel und Ziemer, die verschiedenen Krähenarten, Dohle, Wachtel, Bekassine, Turtel- und Hohltaube, Schwarz- und Grünspecht, Wald- und Steinkauz, Sturmschwalbe, Möwe, Eisvogel, Sperling, Gans, Ente, Schwan, Perlhuhn, Pfau u. v. a. zu erwähnen, die alle mehr oder weniger gute Wetterpropheten sind.
Diese volkstümlichen Voraussagen schlechtweg unsinnig zu nennen, wäre töricht; aber wo die Grenze[194] zwischen Dichtung und Wahrheit, zwischen Einbildung und wirklicher Erfahrung liegt, ist nicht festzustellen, handelt es sich doch wohl niemals um genaue Beobachtungen, die längere Zeit fortgesetzt worden wären.
Nur eine Prophezeiung will ich noch herausgreifen, die alle an Kühnheit der Logik übertrumpft. Sie weckt mir liebe Erinnerungen aus der Kinderzeit, indem sie meinem geistigen Auge, Geruchs- und Geschmacksorgan den verheißungsvollen Anblick, den lieblichen Duft und den köstlichen Genuß der gebratenen Gans daheim im Elternhaus wieder vorzaubert. Der liebe Martinsvogel stellte sich am 11. November, meinem Namenstage, stets ein. Sieht an diesem Tage das Brustbein des festlichen Bratens braun aus, so folgt ein frostreicher, aber schneefreier Winter; hat es dagegen eine weiße Färbung, so gibt's Schnee in Menge.
Ungemein groß ist die Rolle, welche die Tiere in der Volksmedizin früherer Zeiten, besonders im 16. und 17. Jahrhundert, gespielt haben. Man braucht nur die alten Medizinaltaxen oder Apothekerordnungen jener Zeit durchzusehen, und man wird über die Menge allein der einfachen Arzneimittel, der sogenannten »Simplicia« erstaunt sein, die dem Tierreich entnommen wurden.
Dresden schlug mit der Reichhaltigkeit seiner Hofapotheke jeden Mitbewerber auf diesem Gebiete aus dem Felde. Die sächsische Residenz galt von jeher als eine vornehme Stadt; war es nicht vornehm, daß sie auch viele und seltene Krankheiten in ihren Mauern beherbergte und die Hofapotheke für eine jede ein unfehlbares Heilmittel besaß? Die Apothekertaxe vom Jahre 1652 zählt nicht weniger als 190 Stücke aus dem Tierreich[195] auf, darunter Augen, Gehirn, Fett, Galle, Magen, Federn, Mist der verschiedensten Vögel. Mit dieser Herrlichkeit ist's heute vorbei. Aber das Volk hat sich doch noch so manches erhalten; denn die Völker haben ein gutes Gedächtnis und bewahren, ganz wie die einzelnen Menschen, Eindrücke aus früher Kindheit gar getreu bis ins Alter.
Noch heute glaubt man ganz allgemein, nicht nur in unserm Erzgebirge oder im Thüringer Wald, sondern z. B. auch im Salzkammergut, daß der Kreuzschnabel, den die Gebirgsbewohner so gern im engen Drahtbauerchen halten, Gicht, Rheumatismus und alle »Flüsse« anziehe. Auch das Wasser, in dem sich der Kreuzschnabel gebadet hat, sei gut gegen die Gicht wie gegen Krämpfe. Nicht selten stirbt ja gerade dieser Vogel unter krampfartigen Erscheinungen schon nach kurzer Zeit der Gefangenschaft, und oft bezeugen es knollige Anschwellungen an seinen Füßen ganz deutlich, daß die Gichtknoten seines Pflegers auf ihn übergegangen sind.
Wer Kügelgens »Jugenderinnerungen eines alten Mannes« gelesen hat, der wird sich mit Vergnügen des originellen Landgeistlichen Roller, Pfarrherrn zu Lausa, erinnern, der alljährlich an die hundert Elstern im Backofen verkohlte und das so gewonnene schwarze Pulver als Medizin weithin versandte, sogar nach dem Harz und nach Schlesien, nach Hamburg, Königsberg und Wien. Ein fechtender Handwerksbursche hatte dem Pfarrer »die Tugenden« der gebrannten Elster, Alster, Schalaster, Hester, oder wie der langschwänzige Vogel sonst noch genannt wird, gepriesen, und Roller probierte die Sache nun an seinem Bruder Jonathan, der an epileptischen Krämpfen litt. Schon nach Monatsfrist war[196] das Übel behoben; der Pfarrer aber, der von der Wirksamkeit des seltsamen Mittels fest überzeugt war, freute sich nun, daß ihm Gott einen Weg eröffnet habe, sich für die Heilung seines Bruders dankbar zu erweisen und wehrte beharrlich jede Bezahlung ab. Er verlangte nichts anderes von seinen Patienten, als einen gewissenhaften Bericht, wie die Medizin bekommen sei.
Noch heute ist »gebrannte Elster« ein Volksmittel gegen die »hinfallende Krankheit«. Einige wollen wissen, nur die »in den Zwölfen«, d. h. in den zwölf Tagen zwischen Weihnachten und Heil. Dreikönige (6. Jan.) geschossenen Elstern seien bei Krämpfen und Epilepsie heilsam; denn um diese heilige Zeit habe die Natur all ihre Wunderkräfte beisammen. Man glaubt auch, die Elster selbst sei mit der »schweren Krankheit« behaftet, und deshalb vermöge sie beim Menschen das Leiden zu heilen. Gleiches soll eben durch Gleiches vertrieben werden. Vielleicht hat das unruhige, allzeit quecksilberne Wesen der Elster Veranlassung gegeben, bei ihr epileptische Zufälle anzunehmen; doch scheint es mir näherliegend, daß man die Elster, die ein Hexentier ist, d. h. ein solches, in das sich Hexen und andere Dämonen gern verwandeln, aus dem Grunde mit Veitstanz und Fallsucht in Zusammenhang gebracht hat, weil dies Krankheiten sind, mit denen nach dem Volksglauben dämonische Mächte den Menschen heimsuchen.
Das leitet uns über auf das Gebiet des eigentlichsten Aberglaubens.
Bekannt ist das Kuckucksorakel: so viel mal der Vogel ruft, so viele Jahre hat der Frager noch zu leben. Schon i. J. 1221 wendet sich Cäsarius Heisterbach mit Entrüstung gegen diesen altheidnischen Aberglauben,[197] und um dieselbe Zeit war's, da brach ein schon betagter Mönch sein Klostergelübde, weil ihm der Gauch noch 22 Jahre geweissagt hatte. Ob der prophetische Vogel in diesem Falle recht behalten hat, wird leider nicht berichtet. Sollte mich freuen, wenn's so gewesen wäre.
Heute wird wohl niemand mehr ähnliche wichtige Entscheidungen von dem Lenzesboten abhängig machen; man zählt die einzelnen Kuckucksrufe nur zum Spaß und aus alter Gewohnheit. Und doch, ich kenne Personen, die ganz still und niedergeschlagen wurden, als der Kuckuck, den sie befragten, nur zwei- oder dreimal seinen Ruf hören ließ. Solche Macht haben uralte abergläubische Vorstellungen noch in unserm Jahrhundert, auch wenn man sie als Dummheit erkennt.
Der Kuckuck war als Frühlingsbote, ebenso wie der Storch, dem Donar geweiht, der nicht nur als Herr des Gewitters, sondern auch als Frühlingsgottheit verehrt ward. Donar weckte das Leben auf der Erde, gab reichen Erntesegen und beschenkte die Ehen mit Nachkommenschaft. So ward sein Bote, der Kuckuck, zum Lebensvogel, den man nach der Zahl der Lenze befragt, die uns die Gottheit noch beschieden hat, der durch seinen oft wiederholten Ruf dem Landmann Berge von Gold verspricht, daß er die Geldstücke im Sack schon klappern hört, wenn auch nur erst die grünen Spitzen der Saat aus dem Boden hervorschauen und die Obstbäume nur aus ihrem Blütenansatz auf eine reiche Ernte hoffen lassen. Auch den heiratslustigen Dorfschönen erteilt der Kuckuck auf manch' vorwitzige Frage bereitwilligst Auskunft.
Ob er einst verklingen wird in ferner Zukunft, dieser Glaube an den göttlichen Vogel? Weit länger als ein Jahrtausend ist's her, da hat christlicher Eifer die heidnischen[198] Götter entthront und zu Dämonen gestempelt; aus den ihnen geweihten Tieren aber hat er Teufel und Hexen gemacht. »Hol dich der Kuckuck!« – »Geh zum Kuckuck!« – »In Kuckucks Namen« und was derartige schöne Redensarten mehr sind, bei denen sich hinter dem Kuckuck der Teufel versteckt. Der »Lebensvogel« wird aber über diese barbarische Vergewaltigung seiner Person schließlich doch den Sieg davontragen. Ich glaube, so lange der Kuckuck in unsern deutschen Ländern seinen Ruf erschallen läßt, so lange wird auch unser Volk sich den alten Glauben an die prophetische Gabe des geheimnisvollen Vogels bewahren. Jedes Frühjahr weckt ihn von neuem – unsterblich die Erinnerung des Volks an seine Kindheit.
Rechte Hexentiere sind auch die Eulen, die einst als Sinnbild der Wachsamkeit, der Weisheit, des tiefen Denkens und unermüdlichen Forschens von einem nach Schönheit und Weisheit strebenden Volk der helläugigen Pallas Athene geweiht waren. In der christlichen Kunst ward die Eule zum Symbol heidnischer oder irdischer Torheit; ein Kreuz, das man häufig über ihrem Kopfe anbrachte, sollte den Sieg der Kirche über jede teuflische Lehre bedeuten. Und noch heute bekreuzigt sich mancher, wenn das niedliche, harmlose Steinkäuzchen sein helles »kuwitt« und dann das gedämpfte »boh boh« hören läßt. »Das Leichen- oder Totenhuhn, die Wehklage oder Klagemutter ruft: komm mit, komm mit, auf den Kirchhof, hof, hof! Der Vogel kündet den Tod an.« Und nicht etwa nur das ungebildete Volk, nein auch viele andere, die sich unendlich erhaben dünken, glauben dem Unheil kündenden Vogel; oder wenn sie's auch nicht glauben, sie[199] können sich doch eines unbehaglichen Gefühls nicht erwehren, wenn sie das Käuzchen schreien hören.
Natürlich hat in erster Reihe das nächtliche Treiben die Eulen in Verruf gebracht. Völlig geräuschlos, geisterhaft wie ein Schatten gleiten sie an dem Wanderer vorüber, und es funkeln ihre riesigen Augen. Wenn sich der Uhuruf mit dem Brausen des Sturms paart, der im Hochwald tobt, daß die Bäume ächzen und stöhnen, gibt's ein grausig Geheul. An dem Mond jagen die Wolken vorüber, daß sein Licht bald verdeckt wird, bald wieder hell hervortritt zwischen den im Sturme schwankenden Baumkronen. Selbst des Mutigsten Seele wird mit Bangen und Grauen erfüllt. Ist es ein Wunder, daß unsre Altvordern gerade der wilden Sturmes- und Wolkengöttin die Eule als ihr Tier neben der nächtlichen Wildkatze geweiht haben! Zu Hexentieren sind beide unter dem christlichen Einfluß geworden, gehaßt und verfolgt vom unverständigen Volk. Und unter diesem Haß hat die Hauskatze, die die Stelle ihrer wilden Verwandten eingenommen hat, noch heute ebenso zu leiden wie sämtliche Eulen, die nützliche Schleiereule wie der niedliche Steinkauz.
In meiner Jugendzeit sah man es gar nicht selten, daß der Landwirt eine Eule mit ausgebreiteten Flügeln an das Scheunentor oder an die Tür des Viehstalls genagelt hatte. Ich glaubte, diese Unsitte habe sich längst überlebt; aber erst vor kurzem hat mich der gleiche Anblick – es war in der Lausitz – von neuem überzeugt, wie tief doch abergläubische Vorstellungen in unserm Volk wurzeln. Vor Verhexung will der Bauer sein Gehöft schützen. Den herumstreichenden Dämonen, die das Vieh mit bösem Zauber bedrohen, soll das gekreuzigte[200] Tier gewissermaßen zurufen: »Laßt ab von dem Gut! ihr seht, wie's solch nächtlichem Gelichter ergeht!« Allen Verständigen aber, die es sehen, ist die angenagelte Eule nur ein Zeichen dafür, daß Dummheit, Aberglauben, Undankbarkeit und Bosheit unter den Menschen nicht aussterben.
Eine mittelalterliche Hexenküche ohne Eulen wäre nicht denkbar. Und wenn auch das Licht der Wissenschaft in diese Werkstätten menschlicher Afterweisheit hineingeleuchtet hat, es wird doch auch noch heute in verborgenen Winkeln mit Geisterbeschwören, Schatzgraben, Bereitung von allerlei Tränklein viel Hokuspokus getrieben, und die Rolle dämonischer Tiere, wie Elster, Eule, aber auch Katze, Fledermaus, Schlange, Kröte, Salamander u. v. a. ist noch immer nicht ausgespielt.
Zäh hält das Volk an den alten Vorstellungen fest – jahrtausendelang fließt das Wasser in dem einmal errungenen Bett.
Unter den Wirbeltieren sind die Kriechtiere und Lurche die einzigen, die jedes gesetzlichen Schutzes entbehren. Strenge Jagdgesetze nehmen sich vieler Säugetiere und einer großen Anzahl von Vögeln an; nur der Jagdberechtigte darf sie erlegen, und wenn es nicht gerade Raubtiere sind, so genießen sie fast alle eine gesetzliche Schonzeit, die sich freilich in den einzelnen Ländern des Deutschen Reichs auf etwas verschiedene Zeiten erstreckt. Außerdem stehen die meisten nicht-jagdbaren Vögel unter der schirmenden Hand des deutschen Vogelschutzgesetzes, das sich ihrer und ihrer Brut in weitgehendem Maße annimmt. Jedes Schutzes bar sind nach diesem Gesetz nur wenig Vogelarten, ja nach unsern sächsischen Gesetzen keine einzige; selbst die Sperlinge sind nur unter gewissen Einschränkungen »vogelfrei«. Für die Fische sorgen Fischereigesetze in den einzelnen Ländern – nur die Kriechtiere und Lurche sind rechtlos, »vogelfrei«, der Willkür eines jeden preisgegeben. Wenn es sich nicht gerade um Ärgernis erregende Tierquälerei handelt, kann jeder mit diesen Geschöpfen machen, was er will, wozu ihn die Laune treibt. Ungestraft darf er sie und ihre Brut vernichten; da ist kein Gesetz, das ihn hindert. Jedem Tagedieb steht es frei,[202] hinauszuziehen an den Teich, an den Sumpf, an den feuchten Graben der Wiese, an die steinige Halde, in den Buchenwald und dort einzufangen, so viel immer er will, die Läden der Händler in der Großstadt zu füllen. Und wenn es die letzte Ringelnatter am Bachesrand wäre oder der einzige Tümpel in der ganzen Umgebung, den Tritonen und Salamander beleben: er darf, falls sonst kein Einspruch des Besitzers aus besonderen Gründen erhoben wird, das Gewässer ausfischen, den Berghang absuchen und alles mitnehmen, was ihm zur Beute wird, bis auf den letzten Rest.
Was ist der Grund für solche Vernachlässigung und Zurücksetzung der genannten Geschöpfe gegenüber dem weitgehenden Schutz, den namentlich die Vogelwelt allenthalben genießt?
Die Antwort ist nicht schwer. Der leichtbeschwingte, sangesfreudige Vogel ist der Liebling nicht etwa nur einzelner Naturfreunde, sondern aller Kreise unseres Volkes, und wo die Vogelwelt vielleicht doch noch nicht ganz die Teilnahme gefunden hat, die sie verdient, da ist es uns Naturfreunden leicht, für sie einzutreten und um Schutz und Pflege zu werben. Dabei wird man wohl zuerst den großen Nutzen, den so viele Vögel für den Land- und Forstwirt, den Gärtner und Obstzüchter besitzen, ins rechte Licht stellen; denn in der Natur des Menschen ist's nun einmal begründet, daß er in oft recht engherziger Weise zunächst nach seinem eignen Vorteil fragt. Dann aber wird man auch an den freien, fröhlichen Flug erinnern, an die holdselige Stimme so vieler Vögel, an ihr Familienleben, sowohl an das innige Verhältnis der Gatten zueinander, wie an die aufopfernde Liebe der Eltern zu ihren Kleinen, ja selbst zu fremden[203] verwaisten Vogelkindern. In all diesen Wesenszügen wird der Vogel kaum von einer andern Tierklasse erreicht, von keiner übertroffen. Und so sind die Vögel, die Lieblinge der Schöpfung, auch die Lieblinge des Menschen geworden. Sie stehen unserm Herzen, unserm ganzen Gefühlsleben näher als alle andern Geschöpfe, wenigstens wenn wir von den Haustieren absehen.
Wie anders dagegen Eidechsen, Frösche, Molche oder gar Kröten und Schlangen! Ihr bloßer Anblick flößt, wenn auch ungerechtfertigterweise, vielen Menschen Ekel und Abscheu ein. Die schwerfälligen Bewegungen der Kröten und Erdsalamander, die gewiß, ich gebe es zu, der Anmut entbehren, sind manchen geradezu widerlich; aber auch der hastige Lauf der zierlichen Eidechsen, wenn sie über das kurzrasige Gras oder den steinigen Weg hurtig wie die Mäuse dahinhuschen, flößt schreckhaften Menschen Angst ein; das lautlose Hingleiten der Schlangen ist vielen unheimlich, und selbst der hüpfende Frosch ruft in schwachbesaiteten Gemütern Entsetzen hervor. Fast auf jede Weise bewegen sich die Kaltblüter fort: sie kriechen und hüpfen, sie schwimmen und rennen; aber immer finden die Menschen etwas daran auszusetzen. Selbst wenn die Kröten und Echsen fliegen könnten, ich glaube, es würde auch keinem recht sein.
Es gibt Menschen, denen sind Spinnen und Würmer ebenso schreckliche Wesen, und ich kenne Damen, die laut aufkreischen, wenn ihnen 'mal ein summender Maikäfer oder ein Mistkäfer in die Nähe kommt oder gar eine Fledermaus ihnen um die wuschligen Haare flattert, die echten oder die falschen – entsetzlicher Gedanke! Aber es scheint mir, die Abneigung gegen die Kriechtiere und Lurche ist doch noch viel allgemeiner[204] verbreitet; es findet sich so selten 'mal einer, der diesen verachteten und verfolgten Tieren freundlich gesinnt ist. Und selbst wenn man mit verständigen Gründen solche Vorurteile zu widerlegen sucht und gütlich zuredet, sich doch den Salamander, die Blindschleiche, den Frosch genauer zu betrachten, die Tiere wohl auch 'mal in die Hand zu nehmen, so begegnet man bei fast allen dem hartnäckigsten Widerwillen. »So kalt und so naß!« heißt's beim Frosch, bei der Schlange: »so glatt!« und bei der Kröte: »so ekelhaft und giftig ihr Schleim; ich werde mich hüten.«
Doch nicht bloß ihre äußere Erscheinung, auch die Lebensweise der Kriechtiere und Lurche ist vielen höchst unangenehm. An dunkeln Orten, in feuchten Löchern hausen sie, in Morästen und Sümpfen; sie scheuen vielfach das Licht des Tages, wie Kröten und Unken, die erst gegen Abend recht lebendig werden: kurz, es sind unheimliche Geschöpfe. Kein Wunder daher, daß sich der Aberglaube ihrer bemächtigt hat, mehr als irgend einer andern Tierklasse. Die meisten Menschen wissen nicht viel von unsern Kaltblütern zu sagen; wenn sie aber etwas von ihnen berichten, dann sind's gewöhnlich erlogene, abergläubische Märchen; auf jeden Fall aber ist's etwas Böses.
Gern räume ich ein, daß es auch gescheite Leute gibt – meine Leser rechne ich alle dazu, auch bin ich so glücklich, persönlich solche zu kennen – die nichts wissen wollen vom bösen Blick der Schlangen, vom Unglück verkündenden Unkenruf, und was derartige Märchen mehr sind; aber diese abergläubischen Vorstellungen, teils Jahrtausende alt, liegen gewissermaßen in der Luft; sie umgeben die Tiere, von denen wir sprechen,[205] wie ein übler Dunstkreis und tragen wesentlich zu dem Abscheu bei, den die große Menge beim Anblick unsrer Kriechtiere und Lurche empfindet.
»Geh mir mit solch giftigem Gewürm ein für allemal aus dem Wege!« wie oft habe ich's hören müssen, wenn ich als Junge seelenvergnügt eine Ringelnatter in der Hand hielt oder in der Einmachbüchse, die ich der Mutter entwendet hatte, später in meiner »zoologischen Botanisiertrommel« Eidechsen oder ein paar buntfleckige Molche mit heimbrachte! Und wie oft sehe ich's heute noch: am Wiesenweg eine Natter, die man in roher Weise gesteinigt hat, am Waldesrand eine mit Rutenschlägen getötete Blindschleiche, an der Parkmauer eine halbtote Kröte; erst wenn die Sonne untergeht, kann sie sterben, behauptet der Volksglaube.
Der Haß gegen diese Tiere und ihre Verwandten ist ganz allgemein; jeder glaubt ein Recht zu haben, sie zu vernichten, ja er schwatzt sich's vor, es sei seine Pflicht, und mancher dumme Junge fühlt sich als ein Held, als ein Ritter Georg, weil er eine unschuldige Natter oder Blindschleiche erschlagen hat. Immer nur Ausnahmen, wenn sich 'mal jemand dieser hart verfolgten Tiere erbarmt, und wer für sie eintritt, findet kaum je Gehör, ja mit Spott und Hohn antwortet man ihm.
Aber gilt es nicht auch von diesen Kleinen und Schwachen, den Verachteten und Verfolgten, daß sie Kinder der Natur sind, unsrer gemeinsamen Mutter, der wir Verehrung und Liebe zollen sollen? Gehören sie nicht auch mit zu denen, die der große Dichter »meine Brüder im stillen Busch und im Wasser« nennt? Ihr Leben mutwillig zu vernichten, dazu haben wir kein Recht. Hat sich die Schöpfung etwa nur deshalb mit[206] Pflanzen und Tieren geschmückt, »ein jegliches nach seiner Art«, daß wir uns an ihnen vergreifen sollen, sei es aus Roheit, sei es aus törichter Selbstüberschätzung? Heißt das nicht zerstören und verstümmeln, was uns erheben, erquicken, erbauen und erziehen soll! Naturschänder sind es, die anders denken und handeln, und Naturschänder sind mir immer als die erbärmlichsten Menschen erschienen. Die Natur, die uns der Inbegriff alles Schönen sein soll, muß uns auch ein Heiligtum sein, in noch höherem Grade unverletzlich und unantastbar als das größte Kunstwerk. Dieses hat Menschengeist ersonnen und Menschenhand gebildet; die Natur aber trägt den Stempel der Gottheit.
Wer an der Natur frevelt, vergeht sich aber nicht nur an dieser, sondern zugleich an seinen Nebenmenschen, deren natürlichste und deshalb heiligste Rechte er mißachtet und beeinträchtigt. Denkt denn der Frevler, der eine Blindschleiche, eine unschuldige Schlange niederschlägt, nicht daran, daß noch andere des Weges kommen, denen der Anblick eines solchen Tieres Freude bereitet, die den schlängelnden Bewegungen der Natter mit Vergnügen zuschauen, ebenso dem flinken Lauf der zierlichen Eidechsen, wenn deren Gewand im Sonnenstrahl funkelt und gleißt, als sei es mit hundert Smaragden geschmückt, die auch gern 'mal solch Tierchen in die Hand nehmen, um es noch genauer zu betrachten: das allerliebste Schuppenkleid, die wie Perlen blitzenden Äuglein, die tastende Zunge. Nun sieht man das Tier, das noch vor kurzem sich seines Lebens freute und so manchen Naturfreund erfreut hätte, kläglich erschlagen am Boden. Der Frevler hat mit roher Hand allem ein Ende bereitet: dem unschuldigen Tierchen und der unschuldigen Freude.[207] Hat nicht jeder, auch der Ärmste ein Anrecht an die Natur?
Von mancher Seite hat man der Terrarien- und Aquarienliebhaberei den Vorwurf gemacht, daß sie wesentlich zur Verödung der Natur beitrage. In der Tat hat diese Liebhaberei während der letzten Jahre vor dem Weltkriege in weiten Kreisen unsrer Bevölkerung bei jung und alt Eingang gefunden, zum Teil auf Kosten der Stubenvogelpflege, während in meiner Jugendzeit meist nur wir Kinder solch innigen Verkehr mit unsern heimischen Kaltblütern pflegten. Das wachsende Interesse an den genannten Geschöpfen kann ich nur mit Freude begrüßen. Wer Gelegenheit hat, diese Tiere näher kennen zu lernen, wird sie auch lieben lernen. Was man aber liebt, das sucht man zu erhalten und zu schützen. Und so liegt es mir ganz fern, den Freund und Pfleger von Schlangen, Eidechsen, Molchen u. dgl. tadeln zu wollen, wenn er im Frühjahr auszieht, um seinem Terrarium oder Aquarium daheim, an dem er seine Freude hat, Ersatz zu schaffen für das, was ihm der Winter geraubt hat. Der verständige Freund der Natur wird durch Schutz und Pflege seiner Lieblinge draußen in Wald und Flur, in Sumpf und Teich der Heimat reichlich vergelten, was er ihr raubt. Das gilt vom Terrarien- und Aquarienliebhaber genau so wie vom Freund und Pfleger der heimatlichen Stubenvögel.
Aber den Umstand beklage ich tief, daß nun Fänger von Profession diese an sich erfreuliche Liebhaberei zu einem Geschäft ausnutzen, indem sie im Frühling Tag für Tag mit ihren Fanggeräten zu erbeuten suchen, so viel sie nur können, Massenfang treiben der[208] übelsten Art. Der Händler nimmt alles, je mehr, desto besser; er hat für alles Verwendung. Was bei unsachgemäßer Pflege krepiert, kommt in Spiritus und findet auch dann seine Abnehmer. Und so wimmelt es zu manchen Zeiten in den zur Schau gestellten Glaskästen der sog. »Zoologischen Handlungen« der Großstädte von zierlichen Eidechsen, von Nattern und Blindschleichen, von Erdsalamandern, von Tritonen und Molchen. Wirkliche Raubzüge werden gegen die heimatliche Natur unternommen. Nicht die Tierpflege an sich verurteile ich, sondern den Massenfang, wie er zumeist von arbeitsscheuen, recht zweifelhaften Personen Jahr für Jahr des Geldgewinns wegen betrieben wird. Ihnen sollte wie den Vogelstellern durch gesetzliche Bestimmungen das lichtscheue Handwerk gründlich gelegt werden. Freilebende Tiere zur Massenware zu erniedrigen, ist ein Unrecht.
Was nun aber fast ebenso schlimm, jeder kann diese lebende Ware für verhältnismäßig wenig Geld beim Händler erstehen. Da mag so mancher, der die Tiere im Schaufenster sieht, denken, solch ein Behältnis mit Schlangen und Eidechsen, solch Wassergefäß mit Molchen könntest du dir in deinem Zimmer auch einrichten, und er setzt nun die Ringelnatter, den Laubfrosch, den Erdsalamander den ganzen Tag der Sonnenbestrahlung aus, bringt die Tritonen in ein gefülltes Wasserglas, wo sie kein Plätzchen zum Ausruhen finden, und um die Nahrung der Tiere kümmert er sich auch nur wenig. Die ist schwer zu beschaffen; wen der Hunger plagt, so denkt er, wird nicht wählerisch sein. Unter solchen Umständen gehen die armen Geschöpfe natürlich sehr bald zugrunde. Dann ist die ganze Herrlichkeit aus, und am Ende freut[209] sich der Besitzer, der von Tierpflege keine Ahnung hat, daß er die Sache wieder los ist. Der Händler aber hat für die ganz zwecklos geopferten Tiere schon längst wieder Ersatz.
Das sind natürlich Auswüchse der Tierliebhaberei, Nebenerscheinungen, die aber vom Standpunkte des Naturschutzes aus sehr zu beklagen sind. Freilich den meisten Menschen wird's gleichgültig sein, handelt es sich dabei doch bloß um Eidechsen, Molche und ähnliches Getier, und solch »Ungeziefer« hat keinen wirtschaftlichen Wert, wie ihn z. B. der Vogel besitzt, ist auch für den Haushalt der Natur ganz gleichgültig.
Dieser allgemein verbreiteten Ansicht kann nicht scharf genug widersprochen werden. Gewiß, unserm Fühlen, unserm ganzen Innern steht der Vogel viel näher als Blindschleiche oder Unke; aber was den wirtschaftlichen Nutzen der Vogelwelt betrifft, da sind doch nicht wenige unsrer gefiederten Freunde, die manchen Schaden und Ärger anrichten und die das Gesetz doch in seinen Schutz nimmt, und zwar mit größtem Recht; denn der Geldbeutel allein darf nicht den Ausschlag geben.
Wie steht es aber in dieser Beziehung mit den Kriechtieren und Lurchen? Ich muß diese leidige Frage nach Nutzen und Schaden, so sehr es meinem Gefühl zuwider ist, hier in den Vordergrund stellen, weil man bei unsern Tieren so gar nichts anerkennen will, was ihnen Daseinsberechtigung geben könnte. Das Quaken der Frösche ist den Anwohnern des Teiches verhaßt, die Schlangen sind allen greulich, heimtückisch, gefährlich, widerlich die ganze Gesellschaft. Ich sprach mit einer jungen Dame über unsre heimische Tierwelt und wie so viele schuldlos verfolgte Geschöpfe dringend unseres[210] Schutzes bedürfen. »Sie wollen sich doch nicht etwa auch noch der giftigen Schlangen und Salamander, der Eidechsen und Molche annehmen?« fiel sie mir ins Wort. »Sagen Sie 'mal, Herr Professor, wozu sind denn eigentlich die entsetzlichen, scheußlichen Kröten auf dieser Welt?« »Wozu, mein verehrtes Fräulein,« entgegnete ich, »sind denn eigentlich Sie da? Sie haben Ihren Beruf zu erfüllen im Haus, in der Familie, in der menschlichen Gesellschaft, genau wie jedes andere Geschöpf in seinem Kreise, und wenn Sie Ihrer Aufgabe in allen Stücken so treu und gewissenhaft nachkommen wie die Kröten, die Ihnen so zuwider sind, dann alle Hochachtung vor Ihnen! Übrigens haben Sie sich eine Kröte gewiß noch nicht genau angesehen; sonst müßten Sie wenigstens etwas Schönes an ihr finden, und das sind – erschrecken Sie nicht! – ihre Augen.«
In mildem Goldglanz schauen die Krötenaugen uns so treuherzig und innig an, als wollten die Tiere sagen: Tu uns nichts zuleide! Es liegt etwas unaussprechlich Wehmütiges in diesem milden Blick, etwas von der stillen Poesie des Weihers mit seinen Nixen und Elfen, die sich nach dem Reiche der Menschen sehnen, etwas von märchenhaftem Waldeszauber, etwas Ahnungsvolles und Unwirkliches. Man denkt an den verwunschenen Prinzen, an die Kröte mit dem goldnen Krönchen, von denen die Großmutter uns Kindern so oft erzählte. Krötenaugen blicken ebenso sanft und träumerisch, so innig und seelenvoll wie die schönen Augen meines Rotkehlchens oder draußen am Waldbach die großen braunen Augensterne der Wasseramsel, und ich kann's nicht verstehen, daß Krötenaugen geradezu zum Sinnbilde der Häßlichkeit geworden sind. Wenn man eine[211] Dame anschwärmen würde: »Sie einzig Verehrte, mit Ihren Krötenaugen!« so würde das, so ehrlich es der Freund und Kenner jener Tiere vielleicht auch meint, als eine Beleidigung gelten. Nun, eine Beleidigung, ich gebe es zu, mag es in manchen Fällen auch tatsächlich sein, wo man solchen Vergleich zieht, aber niemals eine Beleidigung für das weibliche Wesen.
Doch zurück zur Frage nach Nutzen und Schaden. Raubtiere sind sie alle, die Reptilien so gut wie die Lurche, nur daß letztere in ihrem Jugendzustande, z. B. als Kaulquappen, an verwesenden Pflanzenstoffen herumnagen. Außer Daphnien, Cyklopiden und andern Krebstierchen werden von allen Lurchen die verschiedenen Mückenarten, Würmer, Schnecken, Larven und Puppen von Wasserinsekten, daneben die Jugendformen der eignen Verwandtschaft verzehrt. Der gewalttätigste Lurch ist unser Wasserfrosch, der Musikant. Insekten und Insektenlarven aller Art, Spinnen, Schnecken, Würmer, Kaulquappen, Fischbrut, selbst kleine Fischchen, aber auch junge Blindschleichen, Wassermolche: alles würgt er hinunter. Der zierliche Laubfrosch hat es auf Fliegen, Kleinschmetterlinge, glatte Räupchen und auf allerlei Würmer abgesehen. Die Kröten und Unken leben gleichfalls von Insekten, Asseln, Spinnen, Tausendfüßern, Nacktschnecken und Würmern.
Auch unsre Kriechtiere sind Räuber; sie erjagen lebende Beute. Die Kreuzotter nährt sich von Mäusen aller Art, von Spitzmäusen, auch Eidechsen, die sie durch ihren giftigen Biß sehr schnell tötet; selbst jungen Vögeln mag sie bisweilen gefährlich werden. Die glatte Natter, auch Haselnatter genannt, macht besonders gern auf Eidechsen Jagd, während die Ringelnatter[212] mit Vorliebe Laub- und Grasfrösche frißt. Als gute Schwimmerin jagt sie aber auch im Wasser nach kleinen, etwa fingerlangen Fischen und Salamandern. Vor der gelbbauchigen Unke freilich und dem Erdmolch scheut sie sich, gleich allen andern Lurchjägern; denn schwarz und gelb, unsre Dresdner Stadtfarben, sind Schreckfarben – natürlich nur in der Tierwelt. Die Eidechsen sind hinter allerlei Kerbtieren her und und verstehen sie sehr geschickt zu erwischen: Grillen, Heuschrecken, Schmetterlinge, Fliegen, Käfer; dazu fressen sie Würmer, Nacktschnecken, ja sie überfallen selbst schwächere Artgenossen, während die Blindschleichen, schwerfälliger in ihren Bewegungen, auf den Fang von Regenwürmern, Schnecken und glatten Raupen angewiesen sind.
Aus diesen Beispielen ergibt sich, daß von einem besonderen Schaden der Reptilien und Amphibien nicht die Rede sein kann, abgesehen von der giftigen Kreuzotter, die aber doch nur in einzelnen Gegenden Deutschlands häufig auftritt. Ja, die meisten Mitglieder dieser beiden Wirbeltierklassen stiften durch die Vertilgung von Würmern und Nacktschnecken ganz entschieden Nutzen. Daß sie auch viele Insekten verzehren, wollen wir ihnen nicht besonders anrechnen; denn unter den Kerbtieren gibt es nützliche, wie schädliche Arten, und in dieser Beziehung wird keine Echse, kein Lurch eine Auswahl treffen. Daß aber manche Wasserinsekten, die der Fischerei Schaden bringen, den Ringelnattern und Fröschen zum Opfer fallen, darf nicht unerwähnt bleiben.
Besonders groß erscheint mir der Nutzen der Kröten. In Gärten, besonders wo Erdbeeren oder Salat gepflanzt sind, da sollte man sich nur freuen, wenn man[213] ein paar Kröten begegnet; sie sind die stärksten Vertilger der schädlichen Nacktschnecken. Das wußte schon vor einem halben Jahrhundert mein Vater; er hieß uns Kinder, wenn wir 'mal auf einem Spaziergang eine Kröte antrafen, den Lurch mitnehmen und ihn in unsern Gemüsegarten setzen. Wir freuten uns stets, wenn wir dort den dicken, wohlgenährten Kröten begegneten und sagten ihnen für ihre freundliche Unterstützung im Kampfe gegen mancherlei Ungeziefer »danke schön!« Später habe ich gelesen, daß englische und belgische Gärtner den Nutzen der Kröten schon seit langer Zeit erkannt haben und daß bei ihnen hier und da Kröten auf den öffentlichen Märkten feilgeboten werden, um als Schutztruppe in den Gärten Verwendung zu finden.
Unsre Kaltblüter haben eine große Menge natürlicher Feinde, infolgedessen es ganz ausgeschlossen erscheint, daß Kriechtiere und Lurche, selbst wenn wir ihnen jeden erdenkbaren Schutz gewähren wollen, überhandnehmen könnten. Die gegen früher veränderten Kulturverhältnisse, die sich nicht wieder zurückschrauben lassen, haben die Lebensbedingungen unsrer Kaltblüter sehr ungünstig gestaltet, und so wird es uns höchstens gelingen, einzelne seltene Arten, deren Bestand gefährdet erscheint, vor dem völligen Untergang zu retten. Die große Masse aber muß zusehen, daß ihre starke Vermehrung die Verluste immer wieder ausgleicht, die ihnen so viele Feinde bringen. Die Eidechsen werden von den Schlangen verfolgt, von Raubvögeln, Krähen, Würgern, von Reihern, Störchen, Haushühnern, von Marder und Wiesel, von Igel, Dachs, Fuchs u. a., und fast all diese Eidechsenjäger sind auch Feinde, oder besser Liebhaber der Schlangen. Selbst der[214] Kreuzotter hilft ihr tödliches Gift nichts; sie wird vom Storch überwältigt, ebenso vom Igel.
Den Lurchen geht es nicht besser wie den Kriechtieren; »alles, alles will sie fressen!« Störche und Reiher, Bussarde, Krähen, Dohlen, Elstern, Fischottern, Dachs, Wiesel, Iltis sind hinter ihnen her. Dazu haben sie viele Feinde in ihren eignen Reihen und unter den Schlangen. Die zarten Froschkeulen erfreuen sich auch im Tierreich vieler Verehrer.
Natürlich bin ich weit entfernt, den genannten Lurch- und Reptilienjägern einen Vorwurf zu machen. Sie sind es ganz gewiß nicht, denen der Rückgang unsrer Kaltblüter zur Last fällt. Den Menschen trifft die Schuld an der Verödung der Heimat, an der Vernichtung ganzer Tiergeschlechter. Man vergegenwärtige sich nur, wie die Landwirtschaft heute jedes Winkelchen ausnutzt, die feuchten Wiesen entwässert, die Feldgehölze und Hecken vielfach beseitigt. Sümpfe werden ausgetrocknet und in Ackerboden verwandelt, Flußläufe geregelt, daß das Wasser zwischen öden, geradlinigen Steinmauern in einer Rinne dahinfließt; die Bäche werden ihrer natürlichen Ufervegetation beraubt, Teiche, Flußarme und Altwässer zugeschüttet und die schönen Auenwälder dem Untergange preisgegeben. Die Forstwirtschaft begünstigt immer mehr das Nadelholz, Kiefern und Fichten, wenigstens ist im Laufe der Jahre an die Stelle so manches schönen Buchenbestandes, der den Boden feucht hielt, einförmiges Fichtenholz getreten. Unter all diesen Maßnahmen unsrer Zeit haben Lurche und Reptilien schwer gelitten, schwerer noch als die Vogelwelt; ihrer versteckten Wohnsitze sind sie beraubt worden. Die Vögel wandern aus, wo sie nicht[215] mehr ihre Lebensbedingungen finden; aber die Amphibien eines Sumpfes, eines Teiches gehen samt ihrer Brut zugrunde, sobald das Gewässer zugeschüttet wird. Die Industrie ist unsern Tieren auch feindlich gesinnt. Die Fabriken, die heute auch in das entlegenste Gebirgstal vorgedrungen sind, verseuchen und vergiften fast jeden Graben, jeden Bach; die Kläranlagen sind ja doch nicht imstande, dem Wasser seine natürliche Beschaffenheit wiederzugeben. Ist's da ein Wunder, wenn die Bewohner des fließenden Elements, die Amphibien, Fische u. a. immer seltener werden, ja aussterben?
In dem trocknen Sommer 1911 weilte ich in meiner Heimat an der Freiberger Mulde. Das war kein Wasser mehr, was im Flußbett talab floß, sondern ein Sammelsurium chemischer Lösungen, in denen kein höheres Lebewesen sich hätte aufhalten können. Ein paar »Jungens« kauerten am kahlen Uferrand und machten sich den Spaß, die Gasblasen anzubrennen und explodieren zu lassen, die auf dem Wasser schwammen. Es war just dieselbe Stelle, die mir vor vierzig Jahren als Jagdrevier auf Ringelnattern so lieb war. Dann führte mich der Weg nach dem Nachbardorf, in dessen Mitte ich den Dorfteich mit seiner reichen Pflanzenwelt vergeblich suchte. Großstädtisch war alles geworden: ein Promenadenplatz mit sein paar gußeisernen Bänken. Die Bauern waren sehr stolz auf diesen Fortschritt der Kultur; mich aber stimmte es traurig. Ich dachte an die Frösche und Unken, die einst die Sommernacht mit ihrem Chor- oder Einzelgesang so reizvoll belebten, an die Ringelnattern, die ehemals bei unserm Nahen sich von dem grünen Uferrand hinab ins Wasser gleiten ließen, an die munteren Tritonen, die an seichten Stellen[216] hin und her schwammen, und an die Wasserkäfer, die zwischen dem Entengrün ihre munteren Spiele trieben. Vergangen, vorbei!
Der Leser wird sagen: das ist alles ganz schön, oder richtiger: das ist alles sehr traurig, aber wir können daran nichts ändern. Wegen der Salamander und Ringelnattern, der Frösche und Unken, die dabei zugrunde gehen, wird sich der Landwirt nicht abhalten lassen, einen Sumpf zu entwässern, eine feuchte Wiese trocken zu legen, wenn er's für nötig oder vorteilhaft hält, und die Anlage von Fabriken kann auf die Kleintierwelt erst recht keine Rücksicht nehmen. Wohin sollte solche Rücksichtnahme auch führen?
So meine ich das selbstverständlich auch nicht. Immerhin bin ich der Ansicht, daß ein einzelner Grundbesitzer oder auch ein Gemeinwesen, eine Behörde in allen Fällen recht eindringlich darüber nachdenken sollte, ob es sich auch lohnt, solch eingreifende Veränderungen der natürlichen Verhältnisse, wie sie die Trockenlegung eines Sumpfes, eines Teiches zur Folge hat, herbeizuführen, und ob es unbedingt nötig ist, gerade den Graben zuzuschütten oder mit Fabrikabwässern zu verseuchen, der schöne Molche und ein paar seltene Fischchen beherbergt, auch im Kreise der Naturfreunde als Fundstätte interessanter Wasserinsekten, Krebstierchen, Polypen usw. bekannt ist. Oder ob es sich nicht vermeiden läßt, das kleine Feldgehölz niederzuschlagen, ob die Weißdornhecke am Wege, das Gestrüpp am steinigen Hang nicht erhalten werden kann. Dort wohnen Blindschleichen und Eidechsen in frohem Verein; es wäre doch schade um diese Kleintierwelt, wenn sie etwa nur einer plötzlichen Laune zum Opfer fallen sollte.
Vielleicht ließe sich auch auf gesetzlichem Wege etwas für unsre Kaltblüter tun. An das Vogelschutzgesetz habe ich oben erinnert. Warum, so frage ich, gibt es nicht ein ähnliches Gesetz zum Schutze der Reptilien und Amphibien? Ich sehe keinen Grund ein, diesen Gedanken abzulehnen. Sie alle, die unter den heutigen Verhältnissen so hart bedrängt werden, die Schlangen – natürlich mit Ausnahme der giftigen Kreuzotter – die Eidechsen und Blindschleichen, die Kröten, die Salamander und Teichmolche, die Laubfrösche und bis zu gewissem Grade auch alle andern Frösche verdienen und bedürfen gesetzlicher Maßnahmen, wollen wir sie unsrer Heimat erhalten. Und wenn es vielleicht auch nicht an der Zeit ist, ein Reichsgesetz zu befürworten, so könnten doch bereits jetzt einzelne Länder und Behörden mit gutem Beispiel vorangehen und durch besondere Landesgesetze oder wenigstens Polizeiverordnungen den Reptilien- und Amphibienjägern von Profession das Handwerk genau so legen wie den Vogelstellern und Eierräubern. Warum soll nur der zur Verantwortung gezogen werden, der sich an einem Vogel oder seiner Brut vergreift, während der Frevler, der eine Kröte, eine Unke oder ihren Laich, eine Eidechse oder eine harmlose Schlange lediglich aus Roheit vernichtet, frei ausgeht?
Ich weiß es, daß gesetzliche Maßnahmen auf dem Gebiet des Naturschutzes im allgemeinen wenig nützen. Aber unser Reichsvogelschutzgesetz möchte heute doch kein einziger Naturfreund missen; es hat im Laufe der Jahre durchaus segensreich gewirkt. Und so verspreche ich mir auch von einem Reptilien- und Amphibienschutzgesetz manches Gute. Dabei wäre wohl zu[218] erwägen, ob ein solches Gesetz nicht etwas mehr Rücksicht auf die Terrarien- und Aquarienliebhaber nehmen könnte, als unser Vogelschutzgesetz auf die Freunde der Stubenvogelpflege. Nur dem Massenfänger und dem Händler müßte das Handwerk gelegt werden.
Freilich, mehr als gesetzliche Bestimmungen helfen Belehrung und vernünftige Erziehung. Wer soll belehrt und erzogen werden? Natürlich die Jugend. Aber nicht etwa nur von den Lehrern, sondern an erster Stelle von den Eltern. Die Schule hat es bereits bewiesen, daß es ihr Ernst ist, die ihr anvertrauten Kinder zum Naturschutz zu erziehen. Davon zeugen so manche Verordnungen und Maßnahmen der Schulbehörden, die alle darauf zielen, in der Jugend die Liebe zur Heimat und die Achtung vor der Natur und ihren Geschöpfen zu wecken und zu pflegen, und davon zeugt in gleicher Weise die freundliche Stellung, welche die gesamte Lehrerschaft in Dorf und Stadt, an Volksschulen wie an höheren Schulen dem Naturschutzgedanken gegenüber von Anfang an eingenommen hat. Ja viele, viele Lehrer sind für unsre Bestrebungen mit freudigster Begeisterung eingetreten und haben sich im Kampfe für sie mit in die vorderste Reihe gestellt. Einmal um der Sache selbst willen, sodann aber auch, weil sie erkannt haben, eine wie hohe erzieherische Bedeutung dem Heimat- und Naturschutz sowohl für den einzelnen Menschen wie für unser ganzes Volk zukommt.
Heute treibt der Lehrer naturgeschichtlichen Unterricht nicht nur innerhalb des Schulzimmers, sondern er führt die Kinder oder jungen Leute hinaus ins Freie, daß sie Pflanzen und Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, die lebenden Wesen: die Blume[219] am Wegrand, die Blindschleiche am moosigen Boden, die Eidechsen an der Geröllhalde, den Falter über der Wiese. Der trockene »beschreibende« Naturgeschichtsunterricht, der sich mit der Betrachtung von Herbarien, von ausgestopften Vögeln, von Spirituspräparaten aus dem Reich der Kaltblüter, von aufgespießten Insekten begnügte, ist wohl für alle Zeiten verlassen. Das Leben redet heute zur Jugend, und es lehrt, ohne daß der Erzieher es nötig hat, viel Worte zu machen, Achtung vor der Natur, vor jedem einzelnen Wesen, das ein Glied des Ganzen ist, und damit auch Achtung vor der Gesamtheit der Schöpfung. Wenn es heute scheinen will, daß die traurigen, tief beklagenswerten Verirrungen auf diesem Gebiet, daß die Verrohung weiter Kreise unseres Volks, von der man mit Recht spricht, damit nicht in Einklang zu bringen sind, so glaube ich darin einen Trost finden zu dürfen, daß es sich nur um eine Krankheitserscheinung handelt, die wohl überwunden werden kann. Möge die Schule unentwegt auf dem eingeschlagenen Wege weiter schreiten! Es ist der richtige, und er muß zum Ziele führen.
Aber das Elternhaus hat nicht gleichen Schritt gehalten. Wie gleichgültig stehen doch die meisten Erwachsenen der heimatlichen Tierwelt gegenüber, wenn es sich nicht gerade um ein Säugetier oder einen Vogel handelt. Ja, Grauen und Furcht, Ekel und Abscheu flößen sie ihren Kindern vor Schlangen, vor Kröten und Salamandern, vor Fröschen und Kaulquappen und vor all dem »giftigen Gewürm« ein. Sie untergraben damit die natürliche Zuneigung, die jedes unverdorbene Gemüt der Tierwelt entgegenbringt, statt durch das eigene Beispiel das Interesse der Kinder an den »Brüdern[220] im stillen Busch, in Luft und Wasser« zu pflegen und zu fördern. Da heißt es: »Was fällt dir ein, wirst doch den ekligen Frosch nicht in die Hand nehmen!« oder: »Geh weg, dort sitzt eine giftige Kröte!« oder: »Pfui, pfui, welch scheußliche Raupe, gleich mach sie tot!« oder: »Eine Schlange! wie gut, daß ich die heimtückische Otter mit dem Stock noch getroffen!« Wollte ich in gleichem Tone fortfahren, so würde ich sagen: »Pfui Spinne, was sind das für törichte, unwürdige, geschmacklose Redensarten Kindern gegenüber!«
Die Kleinen, die anfangs wahllos jedes Tier in die Hand nehmen, glauben es schließlich, was die Erwachsenen sagen; sie kreischen beim Anblick einer Natter auf, sie graulen sich, den feuchtkalten Frosch zu berühren und steinigen die unschuldige Kröte. »Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen.« Die Schule wird erst dann vollen Erfolg haben, wenn die Eltern die Hand mit ans Werk legen. Häßliche, ekelhafte Geschöpfe gibt es nicht. »Gott sahe«, sagt die Bibel in ihrer schlichten Weise, »daß es gut war.« Und noch ein Bibelwort möchte ich den Eltern zurufen; das lautet: »Werdet wie die Kinder!«, d. h. wie die natürlichen, von eurer unvernünftigen Erziehung noch nicht verdorbenen Kinder!
Vor ein paar Jahren setzte ich einen vierzehnjährigen Bengel zur Rede, der eben eine Ringelnatter in grausamer Weise getötet hatte. In Glashütte war's, dem erzgebirgischen Städtchen. Der Junge kam von der Wiese herein nach dem Marktplatz und trug die Schlange, in eine Astgabel geklemmt, triumphierend vor sich her. Eine gröhlende Kinderschar umgab ihn, so daß ich an den Anfang der Schillerschen Ballade vom »Kampf mit dem Drachen« erinnert ward. Der Knabe[221] sagte natürlich, es sei eine giftige Schlange. Und dann berichtete er mir, sein Vater habe gesagt, man müsse jede Schlange, der man begegne, totschlagen, es könnte immer eine Kreuzotter sein. Die verstellten sich manchmal. Genau dieselbe Ansicht haben mir gegenüber auch Erwachsene geäußert, die ich wirklich für ein wenig verständiger gehalten hätte. Man ist eben zu gleichgültig oder zu faul, sich die Merkmale unsrer drei Schlangenarten einzuprägen, und schlägt nun alles tot, was einer Kreuzotter ähnlich aussieht, selbst die so harmlose Blindschleiche. Ich möchte auch wissen, wieviel Haselnattern alljährlich als Kreuzottern an die Behörden eingeliefert und von diesen prämiiert werden. Erst lerne man die drei Schlangenarten – es handelt sich tatsächlich im wesentlichen nur um drei Arten – sicher unterscheiden, und dann, meinetwegen, töte man die Kreuzotter, wenn man eine solche antrifft.
Jene Kinderschar, von der ich erzählte, habe ich natürlich über das begangene Unrecht belehrt und jedem einzelnen Kind die Merkmale der unschuldigen Natter genau eingeprägt. Selbst die größeren Jungen gingen hierauf still und beschämt davon. Einem kleinen blondlockigen Mädchen aber standen die Tränen im Auge; es weinte über den Tod dieser Schlange, genau wie es über ein verendetes Vöglein geweint haben würde.
Schlangen leben in allen Zonen der Erde; selbst in dem kalten Lappland kommt die Kreuzotter noch bei 67° n. Br. vor, und überall werden diese Reptilien vom[222] Menschen gefürchtet, gehaßt und verfolgt; denn wo immer Schlangen sich finden, da gibt es unter ihnen neben harmlosen Geschöpfen auch tückische Wegelagerer, die den offenen Kampf scheuen und ihrem Opfer aus dem Hinterhalt mit vergiftetem Dolch auflauern. Namentlich in den heißen Ländern ist die Zahl der Giftschlangen sehr groß; aber selbst in Europa leben 6 oder 7 Arten, von denen für Mitteleuropa nicht weniger als 4 in Betracht kommen.
Freilich nur die Kreuzotter erfreut sich in unserm Vaterlande allgemeiner Verbreitung. Ihr ist jede Örtlichkeit recht, wo sie Wärme und Nahrung findet. Nur dem Innern großer, dunkler Wälder, die kaum einen Sonnenstrahl durchlassen, bleibt sie fern, auch der sumpfigen Wiese, die ihr kein trocknes Plätzchen bietet. Die andern drei, viel selteneren Giftschlangen aber haben ihr Heim weiter südlich aufgeschlagen, die ursinische Viper in Niederösterreich, die Sand- und die Aspisviper namentlich in Südtirol.
Aber selbst wenn Europa als einzige Giftschlange lediglich die Kreuzotter beherbergte, ja wenn diese, wie es für manche deutsche Landschaft gilt, überall außerordentlich selten wäre, ich glaube die Schlangenfurcht unter uns Mitteleuropäern würde doch ebenso allgemein verbreitet sein. Der gute Ruf einer Familie wird eben nur zu leicht durch ein aus der Art geschlagenes Mitglied untergraben; die andern müssen darunter mit leiden, in unserm Falle die giftlose Ringel- und Haselnatter und selbst die ganz harmlose schlangenähnliche Blindschleiche. Überall bringt man diesen Kriechtieren Mißtrauen entgegen, und die Furcht vor dem »Otterngezücht« ist ganz allgemein.
Auf Grund eigner Erfahrungen muß ich nun aber der Ansicht, die Schlangenfurcht sei dem Menschen angeboren, ganz entschieden widersprechen. Ich habe darüber schon berichtet, sowohl in den von der »Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen« herausgegebenen »Vorträgen und Aufsätzen« wie im »Kosmos«. Führe ich ein kleines, etwa drei- oder vierjähriges Kind ruhig an eine Schlange heran, an eine Ringelnatter, die durch's Gras schlüpft, an eine Haselnatter, die sich am steinigen Hang sonnt, so ist von einer angeborenen, instinktiven Furcht des Kindes vor dem Reptil nicht das geringste zu spüren. Im Gegenteil, das kleine Menschenkind betrachtet das ihm bisher unbekannte Geschöpf mit dem größten Interesse. Ja, fasse ich die Natter und bringe sie dem kindlichen Beschauer ganz nahe, so bedarf es kaum noch des Zuredens, das Kinderhändchen greift nach ihr und betastet das glatte Schuppenkleid; selbst vor der beweglichen Zunge der Schlange weicht es nach einem Weilchen nicht mehr zurück. Dabei muß ich selbstverständlich voraussetzen, daß das Kind seine natürliche Unbefangenheit noch bewahrt hat, daß es nicht bereits Zeuge ward von dem törichten Aufkreischen erwachsener Personen, mit dem gewöhnlich eine Schlange, die sich 'mal zeigt, eine Blindschleiche oder Eidechse begrüßt wird. Ich habe mehrfach derartige Versuche angestellt. Kam es einmal zum Schreien, so trug entweder meine eigne Ungeschicklichkeit die Schuld, oder besonders heftige Bewegungen der Natter, ein weites Aufreißen ihres Mundes, ein unheimliches Zischen schüchterten den kleinen Naturforscher ein. Einer jungen Katze oder einem Kaninchen gegenüber verhält sich das Kind nicht anders.
Wenn man mir aber entgegnet, mein eigenes ruhiges Verhalten, ja meine bloße Gegenwart habe die Kleinen ermutigt, ihre angeborene Schlangenfurcht zu überwinden, so antworte ich, daß es mit einem sogenannten ursprünglichen Instinkte nicht weit her sein kann, wenn er durch solch einfache Mittel zu überwinden, ja in sein Gegenteil umzuwandeln ist. Auch kann ich noch folgendes Erlebnis berichten. An einem sonnigen Maimorgen beobachtete ich ein mir bekanntes, etwa vierjähriges Mädchen, an einem Abhang kauernd, wo es um diese Zeit von Eidechsen geradezu wimmelte. Das Kind bemerkte mich nicht. Seine ungeteilte Aufmerksamkeit war auf die grünschillernden Echsen gerichtet, die aus ihren Löchern hervorkamen, um im Sonnenschein zu spielen. Die Kleine griff nach den flinken Tierchen, sie zu fangen, was ihr freilich niemals gelang, und laut jauchzte sie auf in heller Freude an dem neckischen Spiel. Kein Zweifel, mit Kreuzottern oder Skorpionen hätte sich das Kind ebenso lustig unterhalten.
Aber auch an meine eigne Jugend darf ich erinnern, bin ich doch gewissermaßen unter Schlangen aufgewachsen. Ringelnattern waren im Frühjahr und Sommer meine täglichen Spielgenossen; sie bewohnten in großer Anzahl die Uferränder des Bächleins, das durch unsern Garten floß. An warmen Sommertagen sah man mich selten ohne solches Reptil, oft in jeder Faust eine Schlange, wie Herkules, zum Entsetzen meiner lieben Mutter. Aber erwürgt hab ich sie nicht – die Schlangen nämlich. Daß ich selbst Erwachsenen mit meinen Freunden Furcht einjagen konnte, machte mir Spaß, um so mehr als ich solch törichte Angst nicht begriff. Mein Vater hatte durch die ruhig verständige Art, wie er mit[225] dem Kinde alles, was kriecht und fliegt, voll Teilnahme betrachtete und besprach, mich vor jeder Ansteckungsgefahr durch abergläubische Personen zu hüten gewußt, und bald war ich einsichtsvoll genug, daß mir die Schlangenfurcht anderer nichts anhaben konnte. Anerzogen ist diese Furcht, nicht angeboren, das behaupte ich aus vollster Überzeugung.
Man redet von dem Paradies der Kindheit. Ins Paradies aber gehören Tiere, und mit allen ist das Kind gut Freund. Indessen, die Erwachsenen sind es, die solch paradiesisches Verhältnis unsrer Kinder zur Tierwelt oft in unverantwortlicher Weise stören, die natürliche Teilnahme der Kleinen zu allem, was kriecht und fliegt, untergraben, vielleicht ohne daß sie es wollen und wissen. Wenn etwas dem Menschen angeboren ist, so ist's nicht die Furcht vor gewissen Tieren, sondern im Gegenteil die Zuneigung zu allen Geschöpfen, eine Tatsache, die in wirklich rührend naiver Weise in der Schöpfungsgeschichte der Bibel zum Ausdruck kommt, wo erzählt wird, daß Gott alle Tiere auf dem Felde und alle Vögel unter dem Himmel zum ersten Menschen brachte. Freilich gleich hinter dieser lieblichen Erzählung steht das böse, an die Schlange gerichtete Wort des Schöpfers: »Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen.« Kein Zweifel, dieses Wort des zürnenden Gottes trägt ein gut Teil Schuld an der übertriebenen Schlangenfurcht, die selbst in unsern Tagen noch so viele Gemüter beherrscht.
Die Kreuzotter – es kann nicht oft genug wiederholt werden – ist die einzige Giftschlange in unsrer Heimat. Sie kann auch dem Menschen gefährlich[226] werden; doch gehören Unglücksfälle zu den seltenen Ausnahmen, und gestorben ist infolge eines Kreuzotterbisses, so viel ich weiß, in dem letzten halben Jahrhundert in Sachsen überhaupt niemand. Eine gewisse Vorsicht, besonders an Waldrändern, sonnigen Hügeln ist anzuraten, wenn man sich auf den Boden niederläßt; auch vor dem Barfußgehen an solchen Stellen ist zu warnen. Aber man soll auch nicht übertrieben ängstlich sein und durch solche Angst sich den Genuß an der Natur beeinträchtigen lassen. Am wenigsten aber soll man vor jeder Schlange Reißaus nehmen. Die Kreuzotter flieht, sobald sie den Menschen bemerkt; nur wenn sie überrascht wird und keinen andern Ausweg weiß, sucht sie sich zu verteidigen. Man präge sich doch die Artmerkmale der Kreuzotter ein. Ihre Länge beträgt etwa 50 bis 60 cm; jedenfalls ist eine Schlange, die gegen 1 m mißt, nie eine Kreuzotter. Die Färbung kann recht verschieden sein; grau, braun oder olivenfarben ist der Grundton. Die eigentümliche dunkle Zackenlinie, die längs des ganzen Rückens hinläuft, hebt sich mehr oder minder gut ab; sie besteht aus aneinanderstoßenden Rhomben. Die Unterseite ist niemals hell oder auffallend gezeichnet. Der eigentliche Schwanz, der sich ziemlich deutlich vom Körper absetzt, ist sehr kurz, nur etwa 1/8 oder 1/10 der Gesamtlänge. Die Bewegungen der Otter sind langsam, lassen auch die geschmeidigen Wendungen vermissen, die wir an den Nattern bewundern. Jede einzelne Schuppe trägt längs der Mitte eine kielartige Erhöhung im Gegensatz zu den ganz glatten Schuppen der Haselnatter. Mit der bedeutend größeren Ringelnatter kann man die Kreuzotter nicht verwechseln. Deren Oberseite ist blaugrün oder grünlichgrau gefärbt, die fast schwarzen[227] Schilder der Bauchseite sind weiß eingefaßt. Das untrüglichste Merkmal dieser Natter bilden aber die beiden gelben oder weißlichgelben Halbmondflecken hinter dem Kopfe.
Wenn behauptet wird, auch die Kröten seien giftig und sie schleuderten ihrem Feinde, dem wirklichen oder dem vermeintlichen, aus ihren Hautdrüsen einen giftigen Saft entgegen, so ist dies eine falsche Vorstellung. In der Angst spritzt die Kröte Urin aus, der übel riecht, im übrigen aber ganz wirkungslos bleibt. Man muß den Lurch schon kräftig anfassen, ehe er aus seinen Drüsen die so gefürchtete ätzende Flüssigkeit fahren läßt. Aber auch diese ist dem Menschen gegenüber ganz harmlos, höchstens daß sie an zarten Stellen die Haut etwas rötet, und nur derjenige, der sich sehr viel mit Kröten beschäftigt, wird über unangenehme Wirkungen dieses Saftes, aus dem der Chemiker allerdings stark wirkende Giftstoffe herstellen kann, zu klagen haben. Ähnlich verhält es sich mit dem Feuersalamander, der ja auch als giftig beim Volke verschrien ist. Überhaupt glaubt der gemeine Mann, je bunter und auffallender die Farben solch eines Kaltblüters leuchten und glänzen, um so giftiger sei das Tier, und er hält deshalb z. B. das grünschillernde Männchen der Zauneidechse für viel gefährlicher als das einfacher gefärbte Weibchen. Daß solch Merkmal bei der Kreuzotter gar nicht stimmt, macht keinem das Herz schwer. »Die Kreuzotter ist eine Schlange, und die Schlangen sind ohne Ausnahme giftiges Otterngezücht!« so heißt es ganz allgemein.
Wollen wir unsre kaltblütigen Wirbeltiere der Heimat erhalten, so kommt es an erster Stelle darauf an, solchen und ähnlichen Aberglauben, der sich aus dem[228] dunkelsten Mittelalter bis in unsre Tage herübergerettet hat, endlich einmal auszurotten. Hierbei sollte uns neben der Schule auch das Haus unterstützen. Außerdem aber erwachsen den Aquarien- und Terrarienvereinen manche dankbaren Aufgaben. Wie man Vogelschutzgebiete eingerichtet hat, so lassen sich auch Maßnahmen treffen, die den Schutz der Kriechtiere und Lurche an bestimmten, vielleicht nur eng begrenzten Örtlichkeiten bezwecken. Selbst ein kleiner Verein, dem bloß geringe Mittel zur Verfügung stehen, könnte einen steinigen, unfruchtbaren Berghang oder auch nur eine Schutthalde erwerben, wo Eidechsen und Schlangen ihre Wohnung aufgeschlagen haben, ebenso einen Tümpel, einen Wassergraben, einen kleinen Teich, der von Unken und Fröschen, von Tritonen und Molchen belebt wird. Hier könnten die Mitglieder des Vereins ihre schützende Hand über diese Tiere halten. In vielen Fällen würde es auch genügen, einen Pachtvertrag auf längere Zeit abzuschließen oder den Besitzer gegen eine geringe Abfindungssumme zu verpflichten, alle Veränderungen innerhalb des Schutzgebiets zu unterlassen, welche die Daseinsbedingungen der schutzbedürftigen Kleintierwelt schmälern könnten.
Namentlich wenn es sich um besondere Seltenheiten handelt, sollte man sich der bedrohten Tiere annehmen. Zu solchen Seltenheiten, ja schon zu den eigentlichen Naturdenkmälern gehören die Sumpfschildkröte, die Würfel- und Äskulapnatter, die Smaragd- und die Mauereidechse, die Bergunke, die Geburtshelferkröte u. a. Sind es doch nur ganz wenig Örtlichkeiten in Deutschland, die als Fundstätten des einen oder des andern der genannten Kaltblüter in Betracht kommen.[229] So ist die Sumpfschildkröte außer in Westpreußen und den benachbarten Gebieten nur noch im Regierungsbezirk Lüneburg, an der Unterweser, in Schleswig-Holstein, in der Altmark, im Braunschweigischen und in Schlesien an ganz wenig Orten bekannt. Die Äskulapnatter kommt vereinzelt im Taunus und bei Passau vor, die Würfelnatter hat man in der Meißner Gegend und an der Nahe angetroffen, die herrliche Smaragdeidechse am Oberrhein und bei Passau, während es sich bei verschiedenen preußischen Fundstellen wahrscheinlich nicht um ein ursprüngliches Vorkommen handelt. Und so lassen sich bei einer ganzen Reihe von Kriechtieren und Lurchen die wenigen Angaben über ihre Wohnstätten in Deutschland an den Fingern einer Hand aufzählen. Mag es auch wahrscheinlich, ja sogar sicher sein, daß diese Angaben Lücken aufweisen, so viel steht jedenfalls fest, daß die genannten Tiere über kurz oder lang ganz aus unsrer Heimat verschwinden werden, wenn sich nicht Naturschutz-, Aquarien- und Terrarienvereine, sowie Einzelliebhaber der hart Bedrängten tatkräftig annehmen. Auch durch behördliche Verordnungen läßt sich wohl manches erreichen.
Die Erhaltung der heimatlichen Tierwelt muß das gemeinsame Ziel aller Naturfreunde sein. Die verschiedensten Wege führen dahin. Möge selbst den gefürchteten Schlangen und den verachteten Kröten gegenüber solche Aufforderung eine freundliche Aufnahme finden! Es handelt sich um eine ideale Aufgabe, um
Schutz den Schutzlosen!
Auch unter der niederen Tierwelt haben wir gute Bekannte und liebe Freunde. Freilich weniger die Erwachsenen, als die Kinder. Jene wenden sich meist mit Abscheu oder lächerlichem Widerwillen von dem »Insektengesindel, dem Spinnengezücht und all dem Gewürm« ab – unnützes Ungeziefer, zu nichts anderem auf der Welt, als die Menschen zu ängstigen und zu quälen, vom bösen Feind erschaffen, der ja auch das Unkraut zwischen die Fruchthalme der Felder gesät hat – während die Kinder diesen Geschöpfen viel näher stehen. Ihr Verhältnis zu ihnen ist weit inniger, ursprünglicher, noch ungetrübt durch den Verstand, der immer nur Nutzen und Schaden berechnet, einzig in einem tiefen, wahren, natürlichen Gefühl wurzelnd. Solange das Kind von dem albernen Gerede der Erwachsenen noch verschont geblieben ist, sieht es in jedem Tier, auch dem geringsten, ein ihm bis zu gewissem Grade verwandtes Wesen, etwas Beseeltes, das gleich ihm empfindet. In Einfalt ahnt es den Sinn der Dichterworte:
eine Frage, die der Erwachsene nur mitleidig belächelt. Ohne Scheu nimmt das Kind den Käfer, die Raupe, die Spinne, die Schnecke, den Regenwurm in die Hand, freut sich an ihren Bewegungen, stellt allerlei Fragen an sie und läßt sich von seinen Freunden erzählen. Die geschmacklosen Redensarten, wie: »eklige Raupe« oder »pfui, die häßliche Spinne!« verdanken gewiß nicht einem Kindermund ihre Entstehung.
Unter den Käfern spielt natürlich der »Sohn des Mai's« bei unsrer Jugend eine hervorragende Rolle. Sobald die Birken ihre schwanken Hängeruten mit zartem Grün übersponnen haben, ziehen die Buben mit durchlöcherten Pappkästen oder Zigarrenkisten in den Wald, um die braunen Gesellen von den Bäumen zu schütteln und nach Hause zu bringen. Habe es auch nicht anders getrieben – selige Kinderzeit, wo man sich reich fühlte, wenn man ein paar Dutzend Maikäfer sein eigen nannte!
Wir spielten mit ihnen nach Herzenslust. Sie mußten seiltänzern, einen kleinen Wagen oder Schlitten ziehen; auch als Handelsartikel waren sie hochgeschätzt, besonders die mit rotem Brustschild, die »Franzosen«. Später freilich, wenn die Käfer matt und langweilig wurden, war es aus mit der Freundschaft, und wir warfen sie den Hühnern vor.
In manchen Jahren traten die Maikäfer so massig auf, daß sie auch uns Kindern zuwider wurden, und wenn wir die Verheerungen sahen, die sie anrichteten, wie sie die jungbelaubten Eichen ganz kahl fraßen und unsre Stare mit den Übeltätern nicht mehr fertig werden konnten, zogen auch wir gegen sie zu Felde, genau so[232] wie im Sommer 1922 die Schuljugend den Kampf gegen die Nonne geführt hat.
Andre Käfer erfreuten sich unsrer dauernden Liebe und Teilnahme. Der goldig-grün glänzende Rosenkäfer, wie er mitten in der duftenden Zentifolie sitzt, von deren zarten Blättchen er speist, war unser Entzücken; wir hätten ihm ebensowenig ein Leid zufügen können wie den verschiedenen Marienkäferchen oder Sonnenkälbchen, die uns für heilige Tiere galten.
Auch der seltene Puppenräuber war unser Stolz, nicht weniger so mancher Bockkäfer – der kraftvolle Weberbock mit den lederartigen Flügeldecken, der große Eichenbock, der zierliche Zimmerbock mit seinen riesigen Fühlern – alle Kameraden beneideten uns um unsern Besitz, an dem wir uns doch nur ein paar Tage erfreuten. Ich schenkte den Gefangenen, wenigstens damals, als ich noch keine Käfersammlung besaß, die Freiheit bald wieder. Die Schädlinge zu töten, das kam mir nicht in den Sinn.
Längere Zeit, ja wochenlang hielten wir die Riesen der deutschen Käferwelt, die Hirschschröter, in Gefangenschaft; mit Zuckersaft, den sie sehr gern lecken, fristeten wir ihr Leben. In das Aquarium, das mit Teichmolchen besetzt war, brachten wir allerlei Schwimmkäfer, den Gelbrand, den pechschwarzen Wasserkäfer, den kleinen Taumelkäfer. Wir freuten uns an ihrem lebhaften Treiben, bis wir die raubgierige Gesellschaft, die uns die Molche und die kleinen Fischchen anfraß, verbannen mußten. Auch die Wasserläufer, die wie auf Schlittschuhen über das Gewässer hingleiten, erregten unsre besondere Aufmerksamkeit.
Das höchste Entzücken haben mir aber die Leuchtkäfer bereitet, die »Johanniswürmchen«, wie wir sie nannten. Ich war schon mindestens zehn Jahre alt, als ich das Wunder der fliegenden Funken in einer warmen, gewitterschwülen Sommernacht zum erstenmal anstaunen durfte. Es steht mir der Augenblick unvergeßlich im Gedächtnis, wo solch geheimnisvolle, dem Kinde bisher völlig fremde Wunderwelt mich umgab: leuchtende Funken, die man in die Hand nehmen konnte, ohne sich zu verbrennen, ein »Feuerzauber«, der mich völlig in seinen Bann zog. Noch heute sind mir die Leuchtkäfer, die so still durch das nächtlich-dunkle Gesträuch ziehen oder wie leuchtende Lämpchen am Boden ruhen, ein geheimnisvolles Wunder, das mich immer wieder beglückt.
Mit den Jahren erwachte natürlich der Sammeltrieb in mir; wir Jungen spornten uns gegenseitig an und wetteiferten miteinander. Die in der Äthernarkose getöteten und dann sauber aufgespießten und in dem Kasten systematisch angeordneten Käfer haben mir große Freude bereitet. Ich darf wohl sagen, vieles habe ich dabei gelernt, in der Hauptsache aber doch nur dadurch, daß ich mir selber die Sammlung anlegte. Einige seltenere Prachtstücke, die ich später erwarb oder die mir geschenkt wurden, sagten mir wenig, wie mir denn allezeit die lebenden Insekten beredtere Lehrmeister gewesen sind, als ihre toten, in Reih und Glied aufgestellten Leiber. Und so bin ich denn heute von Käfersammlungen in der Hand von Kindern kein besonderer Freund; in den meisten Fällen kommt nicht viel dabei heraus. Der Feuereifer, mit dem die Sache begonnen wird, flaut oft schon im ersten Jahre ab, und bald steht die kleine Sammlung unbeachtet in einem Winkel.
Wo man aber doch einem Jungen, der sich für die Kleintierwelt unsrer Heimat besonders interessiert, gestattet, sich eine derartige Sammlung anzulegen, da sollte das Eltern- und Erzieherauge darüber wachen. Sonst geht es ohne Tierquälerei und Versündigung an der Natur nicht ab; denn es liegt auf der Hand, daß es auch der jugendliche Sammler sehr bald hauptsächlich auf Seltenheiten abgesehen hat, die ihm, wenn er seine eignen Bedürfnisse befriedigt hat, als Austauschobjekte gegen andre Seltenheiten wertvoll sind. Keinesfalls darf das Sammeln zum Selbstzweck werden; die Beobachtung des lebenden Insekts in freier Natur muß immer die Hauptsache bleiben.
Ein Junge, der sich auf den Totengräber, den Ameisenlöwen, den Goldschmied stürzt und nur daran denkt, die Tiere in die Ätherflasche zu stecken, um sie daheim der Sammlung einzuverleiben, der bringt sich um das beste Teil. Beobachte die Totengräber in ihrer bunten Livree, die Aaskäfer im dunkeln Trauergewand bei ihrer Arbeit, wie sie herbeirennen oder herbeifliegen, wenn sie den Leichnam eines Vogels oder eines kleinen Säugetiers aus der Ferne gewittert haben, wie sie die Erde unter dem toten Körper wegscharren und ihn gleichsam begraben, damit die Larven, die später den Eiern der geschäftigen Käfer entschlüpfen, sogleich Nahrung finden. Beobachte die Laufkäfer, wie sie einen Wurm, eine Kerbtierlarve überfallen, den Ameisenlöwen, wie er mit gehobenem Kopf und geöffneter Kieferzange in seinem Sandtrichter sitzt und auf einen Fang lauert, die Schnell- oder Springkäfer – »Schmiede« sagten wir Kinder – wie sie, lebendige Stehaufchen, so lustig emporschnellen, um aus der Rückenlage wieder auf alle[235] Sechse zu kommen, die grünen Sandkäfer, wie sie auf dem öden Ufergelände stoßweise vor dir auffliegen, oder die scharlachroten Lilienhähnchen, die durch Aneinanderreiben der Hinterleibsringe gegen die Flügeldecken eine so seltsam piepende Musik erzeugen, – und du hast mehr erlebt, als dir die Sammlung zu geben vermag.
Die Kinder, die so glücklich sind, sich viel in freier Natur tummeln zu dürfen, werden mit den Eigentümlichkeiten der genannten und noch vieler anderer Kerbtiere sehr bald bekannt sein. Der seltsame Ölkäfer, »Maiwurm« hieß er bei uns, aus dessen Beingelenken ein gelber, öliger Saft tritt, die »spanische Fliege«, die sich zu Zeiten massenhaft auf Eschen und andern Bäumen einfindet, die Rüsselkäfer mit ihrem igelähnlichen Gesicht und dem stahlharten Chitinpanzer, die metallisch glänzenden Erdflöhe u. v. a.: sie alle sind selbst dem kleinen Kind gute Freunde. Aber doppelt glücklich die Kleinen, wenn sie sehen, daß auch die Erwachsenen ihren Lieblingen Teilnahme entgegenbringen! Wie leicht ist es doch, die jugendlichen Beobachter auf diese oder jene Eigentümlichkeit ihrer sechsbeinigen Spielkameraden hinzuweisen, ihnen allerlei Geschichten aus deren Leben zu erzählen und ihnen so immer mehr Liebe zur Natur und zugleich Achtung vor allen Werken der Schöpfung einzuflößen. Gerade an dieser Achtung und Ehrfurcht fehlt es nicht selten! Vielleicht auch ist es mehr Neugier und Spieltrieb, als Mutwille und Zerstörungssucht, wenn Kinder sich der wehrlosen Insektenwelt gegenüber allerlei Grausamkeiten zu schulden kommen lassen; durch ein gutes Wort, einen Hinweis auf das Wunderwerk der Natur, das sich auch im unscheinbarsten Lebewesen offenbart,[236] kann viel Unheil verhütet werden, Unheil, das weniger die Schöpfung bedroht, als – die Kindesseele.
Auch Schmetterlinge habe ich in großer Anzahl gesammelt, nachdem ich die Kunst erlernt hatte, sie auf dem Spannbrett zu präparieren, daß sie dann im Sammelkasten mit ausgebreiteten Flügeln ihre ganze Farbenpracht zeigten. Damals als Kind sah ich mich auf dem Lande von einem Reichtum, einer Mannigfaltigkeit an Groß- und Kleinschmetterlingen umgeben, daß mir die Artenzahl unerschöpflich schien. Heute ist das anders geworden, namentlich in der Nähe der Großstädte. Eine Verarmung an Faltern ist eingetreten, die ich tief beklage; denn gerade die leichtbeschwingten, bunten »Sommervöglein« sind es, die eine Landschaft aufs reizvollste beleben, wenn sie in großen Scharen über der Wiese ihr anmutiges Spiel treiben, von einer Blume zur andern gaukeln, sich haschen, ausgelassen herumwirbeln, hoch in die Lüfte steigen und dann schnell wieder herabflattern, um sich auf dem Blütenstern niederzulassen, der ihnen Nahrung verspricht. Farbe, Bewegung, Leben – ewig schade, daß wir heute so selten Gelegenheit haben, uns solcher Anmut zu erfreuen!
Gewiß, auch vor einem halben Jahrhundert waren manche Großschmetterlinge in meiner Heimat ziemlich selten, und nicht jeden Tag flog mir ein Segelfalter ins Netz oder ein Schwalbenschwanz, und wenn es uns gelang, manche größere Schwärmer oder Eulen, Liguster- oder Wolfsmilchschwärmer oder gar ein rotes Ordensband mit Hilfe von Apfelschnitten, auf die viele Nachtfalter sehr lüstern sind, zu erbeuten, so waren wir glücklich.
Aber heute fehlen vielerorts auch solche Falter, die[237] früher zu den gewöhnlichsten Erscheinungen gehörten. Den Schmetterlingsraupen mangelt es hier an den zur Entwicklung nötigen Nahrungspflanzen. Wir sagten es schon: man nützt jedes Winkelchen aus und duldet kein Unkraut; das Saatgetreide ist viel reiner geworden, und gewiß ist auch die künstliche Düngung dem Entwicklungsgang mancher Falter höchst nachteilig.
Mich verdrießt es, wenn ich Jungen mit Schmetterlingsnetzen durch die Wiesen rennen sehe: Raubzüge gegen die Natur, aus denen nichts Ersprießliches entspringt – in den meisten Fällen wenigstens. Nicht übertriebene Empfindsamkeit ist es, die mich dies absprechende Urteil fällen läßt; die Natur ist auch grausam, und dem Schmetterling wird's gleich sein, ob er im Rachen einer Eidechse endigt, im Schnabel einer nächtlichen Eule oder in der Äthernarkose des Sammlers. Es sind auch kaum pädagogische Gründe – wie verhärtet müßte mein Herz Pflanzen und Tieren gegenüber geworden sein, wenn Schmetterlings- und Käfersammeln, wenn Pflanzenpressen das Gemüt verrohen müßten – nein, Schutz der Natur ist es, wozu ich nicht eindringlich genug mahnen kann.
Die Zeiten haben sich eben geändert, wollte auch nur ein kleiner Bruchteil unsrer Schuljungen sich eine Schmetterlingssammlung anlegen, so wäre es bald vorbei mit den bunten Faltern, und nur noch Weißlinge würden in unsern Gärten flattern. Auch die Schulen sollten Maß halten im Sammeln von Seltenheiten; einige häufiger vorkommende Vertreter der einzelnen Gattungen und Familien genügen vollkommen. Eine Schulsammlung soll kein Museum sein.
Die Falter im Sammelkasten zeigen wohl ihr buntes[238] Farbenkleid, aber ihr Leben und Treiben kannst du doch erst in freier Natur kennen lernen, ja selbst die Bedeutung der Farben und ihre verschiedene Verteilung auf Vorder- und Hinterflügel bei Tag- und Nachtfaltern wirst du erst begreifen, wenn du die leichtbeschwingten Geschöpfe in ihrer natürlichen Umgebung beobachtest, wie sie ihre bunte Herrlichkeit uns zeigen und dann plötzlich dank ihrer Schutzfärbung unserm Auge entschwinden.
Viel wertvoller als Schmetterlinge zu sammeln erscheint es mir, wenn unsre Jugend sich mit der Aufzucht von Raupen beschäftigt und dann die Falter, die den Puppen entschlüpfen, freiläßt. Die Knaben und Mädchen lernen dabei gar manches und haben dann draußen im Freien, wenn sie einen Schmetterling sehen, noch die besondere Freude, möglicherweise einem guten Bekannten, der ihrer Zucht entstammt, begegnet zu sein.
Viele Feinde unter den Menschen haben die Spinnen; selbst der weitverbreitete Glaube, daß Spinnen Glück bringen, hilft ihnen nur wenig. Auch diese interessanten Tiere zu beobachten, findet sich oft für Kinder Gelegenheit, die auch von dem Erzieher wahrgenommen werden sollte: die Kreuzspinne, wie sie ihr kunstvolles Netz baut, an dessen Fäden sie eiligst dahinrennt, ohne sich zu verstricken, wie sie aus ihrem Versteck hervorschießt, die Fliege packt, die ins Netz geraten ist, und sie umspinnt, oder der seltsame Weberknecht, der »Kanker«, wie er tagsüber in einem staubigen Winkel sitzt und gegen Abend seine acht lächerlich langen Beine in Bewegung setzt, um auf die Jagd nach winzigen Insekten und Spinnen zu gehen, oder die Wasserspinne, die sich gut im Aquarium beobachten läßt; an den Wasserpflanzen[239] spinnt sie sich einen Wohnraum, einer Taucherglocke vergleichbar, von wo sie hervorschießt, sobald ein kleines Wasserinsekt in die Nähe kommt. Überhaupt das Aquarium – in Schule und Haus gibt's kaum ein besseres Anschauungs- und Erziehungsmittel! Tag für Tag ein unversiegbarer Born der Belehrung.
Daneben natürlich die Beobachtung in freier Natur, die niemals fehlen darf. Durch den Garten, der zu meinem Elternhaus gehörte, floß ein klares Bächlein. Nur wer selbst an solch einem Gewässer aufgewachsen ist, vermag zu beurteilen, was das für ein empfängliches Kinderherz bedeutet. Die hübsch gepunkteten Forellen wurden belauscht, wie sie unbeweglich im Wasser »stehen« und dann blitzschnell davonschießen; den Krebsen stellten wir nach, die in den Uferlöchern ihre Wohnung hatten, gleich neben der Wasserratte; die seltsamen »Hülsenwürmer«, die ihren weichen Hinterleib in einem Köcher bergen, den sie aus Pflanzenstengeln, Schneckenhäuschen, Steinchen gar zierlich zusammenfügen, erregten unser Interesse, wie die »Rattenschwanzlarven« der Schlammfliegen und die Larven und Puppen der Stechmücken, die zu Tausenden in einer Pfütze neben dem Bach ihrer weiteren Entwicklung entgegensahen. Rückenschwimmer und Wasserläufer, Larven der blauen Libellen und Eintagsfliegen, Schlammschnecken mit ihrem spindelförmigen Haus und Tellerschnecken – »Posthörnchen« nannten wir sie – es ist nicht möglich, all meine Jugendfreunde hier aufzuzählen.
Viel Freude hatte ich als Kind an Schneckenhäusern. Eine kleine, nette Sammlung, die ich mir damals anlegte. Die niedlichen Gebilde sind oftmals so hübsch gezeichnet, und so mannigfaltig ist die Färbung[240] auch bei derselben Art, daß man immer wieder Neues entdeckt. Ich möchte die Schneckenhäuser der sammellustigen Jugend aufs wärmste empfehlen; denn ohne Sammeln, das weiß ich, geht's nun 'mal nicht ab. Beschränkt man sich auf leere Schneckenhäuser, so tut solch Sammeln niemand weh.
Auch Muscheln bereicherten meinen Besitz, besonders als mir eine befreundete Familie hunderte solch zierlicher Gebilde, wie sie am Strande herumliegen, von ihrem Seeaufenthalt mitgebracht hatte. Zu meiner besonderen Freude fehlten auch prachtvolle tropische Formen nicht; denn überall in den deutschen Seebädern werden auch solche verkauft. Mein Jungenherz schwelgte in dem ungeahnten Reichtum an Formen und Farben.
Nur ein klein wenig Verständnis, ein klein wenig Teilnahme seitens der Eltern solchen und ähnlichen Liebhabereien und Neigungen der Kinder gegenüber! Der Sinn für die Natur empfängt gerade durch den schon in jungen Jahren gepflegten Verkehr mit unsrer heimatlichen Kleintierwelt die stärkste Anregung und damit unsre Naturschutzbewegung – es ist dies meine vollste Überzeugung – die wirksamste Förderung.
Weitere Anmerkungen zur Transkription
Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.
Korrekturen:
S. 55: Dippoldiswaldaer → Dippoldiswalder
Wolfssäule in der Dippoldiswalder Heide
End of the Project Gutenberg EBook of »Meine Brüder im stillen Busch,
n Luft und Wasser«, by Martin Braeß
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK »MEINE BRÜDER IM STILLEN ***
***** This file should be named 62311-h.htm or 62311-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/2/3/1/62311/
Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.